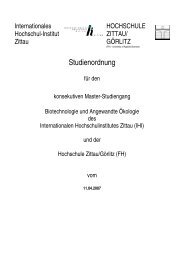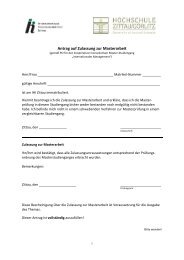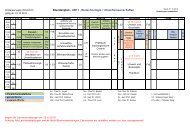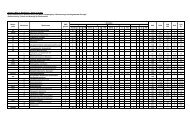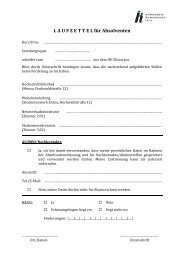Best-Practice-Studie - IHI Zittau
Best-Practice-Studie - IHI Zittau
Best-Practice-Studie - IHI Zittau
- TAGS
- zittau
- www.ihi-zittau.de
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
16<br />
Abbildung 6: Bereitstellungsmodell<br />
Investition, Innovation<br />
Bereitsteller<br />
Vorfinanzierung<br />
Finanzierungsinstitut<br />
Bereitstellungsvertrag<br />
SLA<br />
Leistungspaket<br />
Treuhandkonto<br />
Abbildung 7: Betreibermodell<br />
Baukonzern<br />
Technologieanbieter<br />
Finanzierungsinstitut<br />
Konsortialvertrag<br />
Treuhandkonto<br />
Projektsteuerer<br />
3 FORMEN UND RAHMENBEDINGUNGEN VON ÖPP IN DEUTSCHLAND<br />
Derartige Leistungspakete beinhalten allerdings komplexe Risiken<br />
für den privaten Vertragspartner. Dieser muss sicher stellen, dass<br />
die bereit gestellte Anlage über die gesamte Vertragslaufzeit hinweg<br />
dem jeweils neuesten Stand der Technik entspricht und selten benötigte<br />
Ersatzteile jederzeit verfügbar sind. Daraus ergibt sich die<br />
Notwendigkeit einer Kapitalrendite, die höher sein muss als in vergleichbaren<br />
konventionellen Industrieprojekten.<br />
Zusammenfassend können folgende Voraussetzungen, Erfolgsfaktoren und Regelungsbedarfe benannt<br />
werden:<br />
• technologisch besonders anspruchsvolle Großprojekte mit überdurchschnittlich hohen Qualitätsstandards,<br />
• wartungs- und serviceintensive technologische Anwendungen mit vielen unterschiedlichen Einzelkomponenten,<br />
• grundsätzlich beherrschbare und betriebswirtschaftlich kalkulierbare Entwicklungsrisiken über die<br />
gesamte Vertragslaufzeit hinweg,<br />
• eindeutige vertragliche Definition „neuester Stand der Technik“,<br />
• Untergrenze für Projektvolumina ab ca. 15 bis 20 Mio. Euro,<br />
• Vertragslaufzeiten ab mindestens zehn Jahre,<br />
• deutlich höhere Kapitalrendite als bei stärker standardisierten Industrieprojekten vergleichbarer<br />
Größenordnung,<br />
• freie / übertragbare Investitionsmittel des privaten Partners (outputorientierte Budgetierung /<br />
Globalhaushalt oder kommunale / staatliche Eigengesellschaft mit eigener Rechtspersönlichkeit),<br />
• belastbare Bedarfsprognosen / Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen (Machbarkeitsstudien).<br />
Als Anwendungsgebiete für die im ZVEI organisierten Unternehmen sind folgende Bereiche relevant:<br />
• Medizintechnische Großgeräte / komplette OP-Säle (siehe Beispiel in Kapitel 5.2.4),<br />
• komplexe informationstechnische Großprojekte (z. B. bei Bundeswehr, großen Bundes- oder Landesbehörden).<br />
3.1.2.2 Betreibermodelle<br />
In Betreiber- oder Betreiberfondsmodellen, häufig als Synonym für BOT- oder Investorenmodelle verwendet,<br />
ist der private Partner operativer Verantwortlicher für alle Phasen des Projektlebenszyklus und<br />
zugleich Investor. Die Refinanzierung erfolgt durch ein (eigenes) Finanzierungsinstitut. In Betreibermodellen<br />
übernimmt der private Partner mindestens den Bau („build“) und Betrieb („operate“) öffentlicher<br />
Infrastruktureinrichtungen. T wie „transfer“ steht dafür, dass nach Beendigung der Vertragslaufzeit<br />
das Gebäude oder die Anlage in das Eigentum der öffentlichen Hand übergeht. Zusätzlich können<br />
die Planung („design“), Erhaltung („maintain“), Betriebsoptimierung („train“) und die<br />
Projektgesellschaft<br />
Planung<br />
Bau<br />
Betrieb<br />
...<br />
Anwaltskanzlei<br />
Nutzungsgebühren<br />
SLA<br />
(Pönalen)<br />
Konzession<br />
Beteibervertrag<br />
Transfer<br />
Anschubinvestition,<br />
Machbarkeitsstudie<br />
Auftraggeber<br />
Machbarkeitsstudie<br />
(eigeninitiativ oder in<br />
öffentlichem Auftrag)<br />
Öffentlicher<br />
Partner<br />
Nutzer<br />
Betriebs-/Nutzungsgebühren (Konzession)<br />
Finanzierung („finance“) auf den Privaten übertragen werden.<br />
Komplexität und Laufzeit von Betreibermodellen sind tendenziell<br />
umso höher bzw. länger, je mehr unterschiedliche Aktivitäten in<br />
einem Projekt gebündelt werden (siehe Abbildung 7).<br />
Projektfinanzierung als Prinzip bei Betreibermodellen<br />
Betreiber- oder BOT-Modelle sind im Regelfall am Prinzip der<br />
Projektfinanzierung ausgerichtet. Dies bedeutet, dass jeweils ein<br />
projektspezifisch maßgeschneidertes Planungs-, Umsetzungs-,<br />
Projektmanagement- und Finanzierungskonzept zu entwickeln ist.<br />
Ziel ist dabei, das jeweilige Projekt möglichst weitgehend „aus sich<br />
selbst heraus“ zu finanzieren. Dies gelingt allerdings nach bisherigen<br />
Schätzungen nur bei ca. 50 bis 60 % aller BOT-Projekte. In den<br />
anderen Fällen muss Eigenkapital der beteiligten privaten<br />
Investoren eingebracht werden. Als Umsetzungsorgan für BOT-<br />
Projekte wird üblicher Weise eine Projektgesellschaft (z. B. GmbH,<br />
GmbH & Co KG) gegründet, an welcher der öffentliche Partner eine<br />
3 FORMEN UND RAHMENBEDINGUNGEN VON ÖPP IN DEUTSCHLAND<br />
Minderheitsbeteiligung hält. Derartige Projektgesellschaften unterscheiden sich von gemischtwirtschaftlichen<br />
Unternehmen durch den strikten Projektfokus. Sie dienen ausschließlich der Durchführung eines<br />
Projektes und sind daher nicht auf Dauer angelegt.<br />
Für die Bilanz des privaten Partners sollte sich dadurch keine (unverhältnismäßige) Belastung ergeben<br />
(„Off Balance“). „Unverhältnismäßig“ bedeutet in diesem Zusammenhang, dass die Ratingstandards<br />
unter BASEL-2-Bedingungen möglichst nicht verschlechtert werden. Den privaten Investitionen und<br />
Kapitalkosten (Zins, Tilgung, Transaktionskosten) müssen bei jeder Projektfinanzierung regelmäßige<br />
Einnahmen gegenüber stehen. Dabei kann es sich entweder um Transferzahlungen des öffentlichen<br />
Auftraggebers oder – nach Abschluss der Bau- bzw. Errichtungsphase – Nutzungsgebühren handeln.<br />
Einnahmen aus Konzessionen stellen hier für BOT-Modelle insgesamt den häufigsten Fall dar. Im letzteren<br />
Fall liegen Kombinationen aus Betreiber- und Konzessionsmodellen vor. Derartige Kombinationsmodelle<br />
sind beispielsweise im Verkehrsbereich besonders weit verbreitet (vor allem A- und F-Modelle).<br />
Zusammenfassend können folgende Voraussetzungen, Erfolgsfaktoren und Regelungsbedarfe benannt werden:<br />
• Untergrenze für Projektvolumina ab ca. 10 bis 20 Mio. Euro,<br />
• Vertragslaufzeiten ab mindestens 15 bis 20 Jahre,<br />
• eindeutige Abgrenzung öffentlicher und privater Kompetenzen, Kontrollmöglichkeiten und<br />
Steuerungsinstrumente / Qualitätsstandards (Service-Level-Agreements, SLA),<br />
• gesicherte Finanzierungsströme (Cash Flows) auch im Fall von Projektverzögerungen oder kurzfristigen<br />
Leistungsmängeln (Strafzahlungen / Pönalen),<br />
• belastbare Bedarfsprognosen / Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen (Machbarkeitsstudien).<br />
Als Anwendungsgebiete für die im ZVEI organisierten Unternehmen sind folgende Bereiche relevant:<br />
• BOT-Modelle im Verkehrswesen (z. B. Verkehrsleitsysteme, Lichtsignalanlagen),<br />
• BOT-Modelle in der Wehrtechnik und bei informationstechnischen Großprojekten (z. B. Bundeswehr,<br />
Bundes- und Landesbehörden),<br />
• BOT-Modelle im Bereich der Sicherheitstechnik.<br />
3.1.2.3 Contracting- und Factoringmodelle<br />
Abbildung 8: Modelle Contracting und Factoring<br />
Contractor<br />
Lieferant<br />
Investition<br />
Know-how<br />
Projektgesellschaft<br />
Finanzierungsinstitut<br />
Liefer- / Einspar- /<br />
Modernisierungsvertrag<br />
SLA, Bonus- Malus-Syteme<br />
Auftraggeber<br />
(Anlage)<br />
Ergänzende<br />
Finanzierung<br />
(z. B. Bürgerfonds)<br />
Durch die Beteiligung an Contracting- bzw. Factoringmodellen verfolgen<br />
kommunale oder staatliche Einrichtungen das Ziel, die<br />
Kosten für eingegrenzte Leistungen aufgrund technischer und / oder<br />
organisatorischer Modernisierung deutlich zu senken. Die Leistungsqualität<br />
muss dabei zumindest gleich bleiben. Daneben existiert<br />
auch die Contractingausprägung, eingesparte Investitionen für<br />
Leistungsverbesserungen zu nutzen. Die spezielle Rolle des<br />
Contractors besteht darin, zwischen potentiellen Leistungsanbietern<br />
und -nachfragern zu vermitteln und dabei spezifisches eigenes technisches<br />
und betriebswirtschaftliches Know-how einzusetzen.<br />
Abhängig von den vereinbarten Leistungen wird zwischen Liefer-,<br />
Service- / Dienstleistungs-, Modernisierungs- und Einsparcontracting<br />
unterschieden. Im Fall einer Kostensenkung werden die Einspargewinne<br />
zwischen öffentlichem Auftraggeber und Contractor<br />
nach einem festgelegten Schlüssel aufgeteilt. Vertraglich geregelt<br />
ist dabei ein regulär zu vergütender Einsparkorridor mit einem<br />
Mindesteinsparvolumen (siehe Abbildung 8).<br />
Zusammenfassend können folgende Voraussetzungen, Erfolgsfaktoren und Regelungsbedarfe benannt<br />
werden:<br />
• Ausreichende Länge der Betriebsphase, um Modernisierungs- / Einsparinvestitionen zu amortisieren,<br />
• Anreize für den Privaten, die als Minimum festgelegten Leistungsziele zu überschreiten,<br />
• Untergrenze für Projektvolumina ab einer bis 1,5 Mio. Euro,<br />
• Vertragslaufzeiten ab mindestens fünf bis sieben Jahre,<br />
• belastbare Bedarfsprognosen / Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen (Machbarkeitsstudien).<br />
17