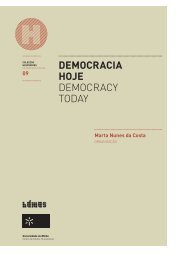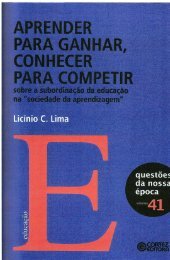Claudia Breitbarth Johann Beer: Der Verliebte Europäer
Claudia Breitbarth Johann Beer: Der Verliebte Europäer
Claudia Breitbarth Johann Beer: Der Verliebte Europäer
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
auf der rechten oder auch „schönen“ Seite. Sie fällt beim Durchblättern eines Buches eher ins<br />
Auge als die linke oder auch „falsche“ Seite (Verso), wo man das Titelkupfer setzte. 35<br />
Titel haben drei grundsätzliche Funktionen, nämlich: das Werk zu identifizieren, seinen Inhalt<br />
und seine Form zu bezeichnen sowie es dem Publikum schmackhaft zu machen.<br />
Die Titelseite zeigt also den Titel, welcher sich als komplexes Gebilde erweist, denn er enthält<br />
außer dem bloßen Titel eine Reihe von in ihn mehr oder weniger verwobenen Informationen.<br />
Neben dem Titel <strong>Der</strong> verliebte Europeer finden sich eingebunden in den Untertitel - dessen<br />
Beginn durch das Oder kenntlich gemacht ist - eine (einstweilige) Gattungsangabe<br />
Wahrhafftige Liebes=Roman und eine Inhaltsangabe unter Nennung des Helden In welchen<br />
ALEXANDRI Liebesgeschichte/ und tapfere Helden=Thaten/ womit er nicht alleine sich bey<br />
den Frauenzimmern beliebt gemacht/ sondern auch in Besichtigung unterschiedliche<br />
Königreiche in Europa/ dero vornehmsten Staats=Maximen angemerckt/ begriffen.<br />
Damit sind die ersten beiden Funktionen erfüllt. Dem Publikum wird das Werk zum einen in<br />
seiner Titelaufmachung, also auch in Einheit mit der Illustration durch das Kupfer und den<br />
Schriftsatz, schmackhaft gemacht, zum anderen durch die Adressierung und vielleicht auch<br />
durch den phantasievollen Autornamen:<br />
Es folgen also die Adressaten 36 allem Curiosen Frauenzimmer/ und klugen Hoff=Leuten zu<br />
sonderbaren Nutz sowie der (angebliche) Verfasser zusammen getragen/ durch Alexandri<br />
guten Freund/ welcher sonst genannt wird AMANDUS DE AMANTO. <strong>Der</strong> Form und Art der<br />
Nennung des Verfassernamens ist bereits zu entnehmen, dass es sich um eine Autorfiktion<br />
bzw. die Vortäuschung eines Herausgebers handelt. Dass er nicht einfach weggelassen wurde<br />
– eine zur damaligen Zeit durchaus übliche Option – bedeutet, dass es dem Autor wichtig war,<br />
die Wahrheit des Erzählten zu beglaubigen (Freund). Dies ist ein Muster, welches von<br />
„echten“ und fiktiven Lebensbeschreibungen bekannt ist und dort den „autobiographischen<br />
Pakt“ mit dem Leser begründet. 37 Da im <strong>Verliebte</strong>n <strong>Europäer</strong> der Verfasser aber nicht<br />
identisch mit dem Helden ist, verlagert sich die Beglaubigungsstrategie auf die Versicherung<br />
der Wahrheit durch die Worte zusammen getragen/ durch Alexandri guten Freund. Denn eine<br />
Nichtidentität verschiebt normalerweise die Erwartungshaltung des Lesers in Richtung eines<br />
35<br />
Diese Formfragen liegen u. a. vornehmlich in der Verantwortung des Verlegers, wie auch die Wahl des<br />
Duodezformats (s. oben 2.1). Sie werden deshalb als „verlegerischer Peritext“ bezeichnet. Wenn der Titel relativ<br />
kurz war, konnte das Kupfer auch auf der Titelseite platziert werden. Von dieser Praxis rückte man ab, als die<br />
Inhaltsangaben auf der Titelseite umfangreicher wurden.<br />
36<br />
Genette unterscheidet zwischen Adressat des Textes: = die Leser und Adressat des Titels: = das Publikum.<br />
Genette 2001, S. 77.<br />
37<br />
Vgl. Lejeune, Philippe 1994: <strong>Der</strong> autobiographische Pakt. Frankfurt/ Main: Suhrkamp (Original 1975: Le<br />
pacte autobiographique).<br />
13