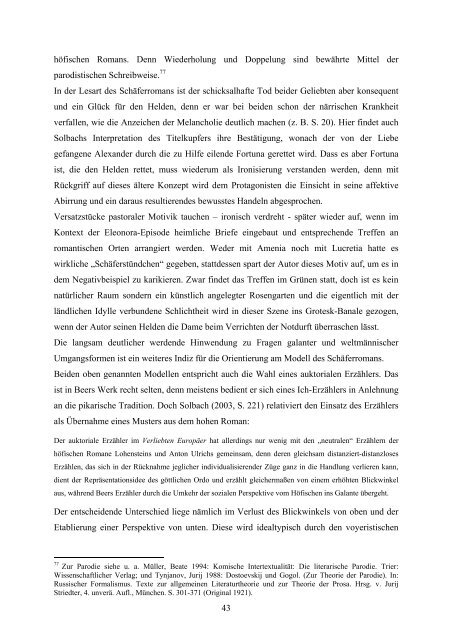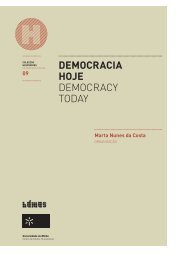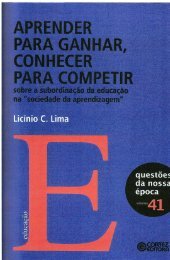Claudia Breitbarth Johann Beer: Der Verliebte Europäer
Claudia Breitbarth Johann Beer: Der Verliebte Europäer
Claudia Breitbarth Johann Beer: Der Verliebte Europäer
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
höfischen Romans. Denn Wiederholung und Doppelung sind bewährte Mittel der<br />
parodistischen Schreibweise. 77<br />
In der Lesart des Schäferromans ist der schicksalhafte Tod beider Geliebten aber konsequent<br />
und ein Glück für den Helden, denn er war bei beiden schon der närrischen Krankheit<br />
verfallen, wie die Anzeichen der Melancholie deutlich machen (z. B. S. 20). Hier findet auch<br />
Solbachs Interpretation des Titelkupfers ihre Bestätigung, wonach der von der Liebe<br />
gefangene Alexander durch die zu Hilfe eilende Fortuna gerettet wird. Dass es aber Fortuna<br />
ist, die den Helden rettet, muss wiederum als Ironisierung verstanden werden, denn mit<br />
Rückgriff auf dieses ältere Konzept wird dem Protagonisten die Einsicht in seine affektive<br />
Abirrung und ein daraus resultierendes bewusstes Handeln abgesprochen.<br />
Versatzstücke pastoraler Motivik tauchen – ironisch verdreht - später wieder auf, wenn im<br />
Kontext der Eleonora-Episode heimliche Briefe eingebaut und entsprechende Treffen an<br />
romantischen Orten arrangiert werden. Weder mit Amenia noch mit Lucretia hatte es<br />
wirkliche „Schäferstündchen“ gegeben, stattdessen spart der Autor dieses Motiv auf, um es in<br />
dem Negativbeispiel zu karikieren. Zwar findet das Treffen im Grünen statt, doch ist es kein<br />
natürlicher Raum sondern ein künstlich angelegter Rosengarten und die eigentlich mit der<br />
ländlichen Idylle verbundene Schlichtheit wird in dieser Szene ins Grotesk-Banale gezogen,<br />
wenn der Autor seinen Helden die Dame beim Verrichten der Notdurft überraschen lässt.<br />
Die langsam deutlicher werdende Hinwendung zu Fragen galanter und weltmännischer<br />
Umgangsformen ist ein weiteres Indiz für die Orientierung am Modell des Schäferromans.<br />
Beiden oben genannten Modellen entspricht auch die Wahl eines auktorialen Erzählers. Das<br />
ist in <strong>Beer</strong>s Werk recht selten, denn meistens bedient er sich eines Ich-Erzählers in Anlehnung<br />
an die pikarische Tradition. Doch Solbach (2003, S. 221) relativiert den Einsatz des Erzählers<br />
als Übernahme eines Musters aus dem hohen Roman:<br />
<strong>Der</strong> auktoriale Erzähler im <strong>Verliebte</strong>n <strong>Europäer</strong> hat allerdings nur wenig mit den „neutralen“ Erzählern der<br />
höfischen Romane Lohensteins und Anton Ulrichs gemeinsam, denn deren gleichsam distanziert-distanzloses<br />
Erzählen, das sich in der Rücknahme jeglicher individualisierender Züge ganz in die Handlung verlieren kann,<br />
dient der Repräsentationsidee des göttlichen Ordo und erzählt gleichermaßen von einem erhöhten Blickwinkel<br />
aus, während <strong>Beer</strong>s Erzähler durch die Umkehr der sozialen Perspektive vom Höfischen ins Galante übergeht.<br />
<strong>Der</strong> entscheidende Unterschied liege nämlich im Verlust des Blickwinkels von oben und der<br />
Etablierung einer Perspektive von unten. Diese wird idealtypisch durch den voyeristischen<br />
77 Zur Parodie siehe u. a. Müller, Beate 1994: Komische Intertextualität: Die literarische Parodie. Trier:<br />
Wissenschaftlicher Verlag; und Tynjanov, Jurij 1988: Dostoevskij und Gogol. (Zur Theorie der Parodie). In:<br />
Russischer Formalismus. Texte zur allgemeinen Literaturtheorie und zur Theorie der Prosa. Hrsg. v. Jurij<br />
Striedter, 4. unverä. Aufl., München. S. 301-371 (Original 1921).<br />
43