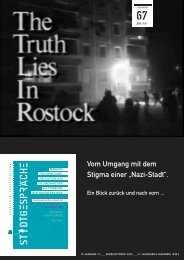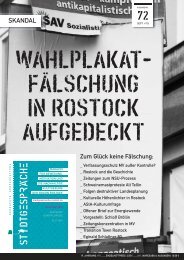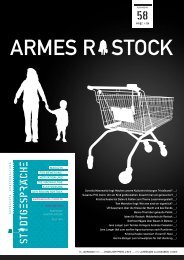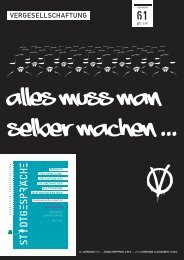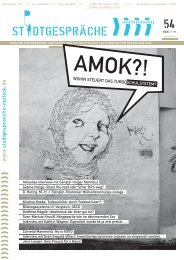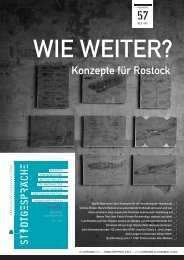FORMEN DES WIDERSTANDS - Stadtgespräche Rostock
FORMEN DES WIDERSTANDS - Stadtgespräche Rostock
FORMEN DES WIDERSTANDS - Stadtgespräche Rostock
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
0.13 __ //// TITELTHEMA<br />
Zum Grundrecht auf<br />
Versammlungsfreiheit<br />
ELKE STEVEN, KOMITEE FÜR GRUNDRECHTE UND DEMOKRATIE<br />
Der Streit um das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit ist alt.<br />
Die Zweifel an der uneingeschränkten Geltung eines Grundrechts,<br />
dessen Inanspruchnahme fast zwangsläufig für Unruhe<br />
sorgt, kommen schon im Grundgesetz zum Ausdruck. Zwar<br />
haben „alle Deutschen“ „das Recht, sich ohne Anmeldung oder<br />
Erlaubnis friedlich und ohne Waffen zu versammeln“ (Art. 8, 1<br />
GG), aber Absatz 2 lässt bereits Einschränkungen für „Versammlungen<br />
unter freiem Himmel“ zu. Eine solche Beschränkung<br />
beschloss das Parlament 1953 mit dem Versammlungsgesetz,<br />
das Demonstrationen als staatliches Sicherheitsrisiko vorstellt,<br />
die es zu kontrollieren und zu beschränken gilt. Allerdings<br />
beschränkt das Versammlungsgesetz das Grundrecht<br />
nicht mehr auf die Staatsangehörigen.<br />
Das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit aus Art. 8 GG, verbunden<br />
mit dem Grundrecht auf Meinungsfreiheit (Art. 5<br />
GG), garantiert den Bürgern und Bürgerinnen eine der wenigen<br />
Möglichkeiten, öffentlich Einfluss auf die politische Diskussion<br />
zu nehmen. Ansonsten blieben sie Stimmvieh für die<br />
Wahlen. Dieses Grundrecht soll vor allem die Andersdenkenden<br />
schützen, denn sie, nicht diejenigen die mit dem mainstream<br />
übereinstimmen, bedürfen diesen Schutzes. Ohne die<br />
manchmal aufmüpfig-selbstbewusste Inanspruchnahme des<br />
Grundrechts wäre es 1985 wohl kaum zu dem grundlegenden<br />
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) gekommen,<br />
mit dem dieses das Grundrecht gegen all die politisch-polizeilichen<br />
Übergriffe zu schützen versuchte.<br />
Seitdem sollte jede Ordnungsbehörde wissen, dass dieses<br />
Grundrecht nicht einfach gegen andere Rechte, Bedürfnisse<br />
und Wünsche aufgerechnet werden kann. Für Auflagen oder<br />
gar Verbote gelten hohe Hürden. Gefährdungen der öffentlichen<br />
Sicherheit müssen konkret und präzise nachgewiesen werden,<br />
um Verbote auszusprechen. Allgemeine Störungen im alltäglichen<br />
Ablauf müssen hingenommen werden. Tatsächlich<br />
aber sind die Auseinandersetzung und die ordnungspolitischen<br />
Versuche, das Versammlungsrecht auszuhebeln, Alltag in der<br />
Bundesrepublik Deutschland geblieben.<br />
Mit dem Vorwurf der Gewalttätigkeit wird jeder Protest diskreditiert,<br />
der die Ordnung nur etwas stört, der die Finger in<br />
die Wunde menschenrechtswidriger, undemokratischer Politik<br />
legt. Die Gewalt der Bürger nähme zu, ist eine immer wiederkehrende<br />
Behauptung welche zur Forderung nach immer mehr<br />
Eingriffs- und Strafverfolgungsmöglichkeiten führt.<br />
Vom polizeilichen Umgang mit Demon strationen<br />
Oft können Demonstrationen sich nicht ungehindert äußern.<br />
Zugangskontrollen schrecken ab. Videoaufnahmen sind bei<br />
fehlenden Anhaltspunkten für eine erhebliche Gefährdung der<br />
öffentlichen Sicherheit und Ordnung rechtswidrig (Verwaltungsgericht<br />
Münster, August 2009). Werden Demonstrationen<br />
als geschlossene Kessel geführt, so wird den Demonstrierenden<br />
die Möglichkeit genommen, Öffentlichkeit zu erreichen.<br />
Die Grundrechte aushebelnden polizeilichen Maßnahmen betreffen<br />
die Teilnehmer um so eher, um so mehr sie provozieren,<br />
um so mehr sie Themen ansprechen, die grundlegende gesellschaftliche<br />
Fragen thematisieren. In den 1980er Jahren wurden