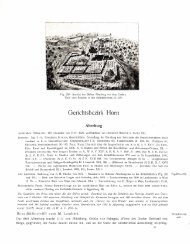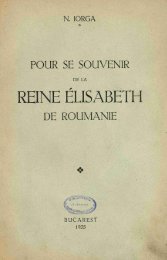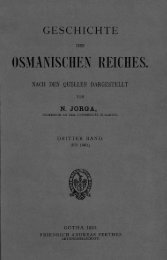Geschichtswerk; Geschichte von Zachenberg (Edition - Wikimedia
Geschichtswerk; Geschichte von Zachenberg (Edition - Wikimedia
Geschichtswerk; Geschichte von Zachenberg (Edition - Wikimedia
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
7<br />
nen in die dem Kloster Metten gehörenden Waldungen einfallen ließen, den Wandlbach (Grenze) überschritten, um auch<br />
südlich des Wandlbaches, in der anderen Hälfte der Gemeindeflur <strong>Zachenberg</strong> durch die Rodungsleute neues Siedlungsland<br />
und neue Siedlungsorte zu erwerben. So entstanden wohl im 11. und 12. Jahrhundert dort die "ried"-Orte:<br />
� Gottlesried = Godilesried,<br />
� Weichselsried = Wigilesried,<br />
� Hasmannsried = Hosnodsried, und im südlichen Teil dieses Gebietes<br />
� Köckersried = Coteschalksried.<br />
Die mit einem Personen- oder Eigennamen zusammengesetzten "ried"-Namen sind lauter echte "ried“-Namen und die<br />
Gründer dieser „ried“-Siedlungen gehören alle einer großen Grundherrschaft an. Das jüngere Alter der "ried"-Orte gegenüber<br />
den "dorf"-Orten ergibt sich auch daraus, dass diese „ried“-Orte im Gegensatz zu den viel älteren Dorfsiedlungen nicht<br />
an der Verkehrsstraße sondern vielfach in ungünstiger Lage zu finden sind. Kleinried ist kein echter "ried"-Name, weil er<br />
nicht mit einem Personennamen zusammengesetzt ist. Kleinried hieß ursprünglich "Gnänried". Gnän bedeutete im Althochdeutschen<br />
7 klein.<br />
Den beiden Siedlungsperioden der "dorf"- und "ried"-Orte gehört auch die Gründung der "berg"- und "burg"- und "bach"-<br />
Siedlungen an, und zwar wiederum in der unteren Gemeindehälfte zuerst, wie dort die "dorf"-Orte und in der oberen Gemeindehälfte<br />
die "ried"-Orte. Zur Zeit der Gründung der Siedlung Fratersdorf, also schon im 9. Jahrhundert, entstand östlich<br />
<strong>von</strong> Fraterdorf die Siedlung Eckersberg = Ekkirisbuch, urkundlich im Jahre 882, südlich <strong>von</strong> Fratersdorf die Siedlung Wolfsberg<br />
= Wolfichosperg und westlich <strong>von</strong> Fratersdorf Vorder- und Hinterdietzberg = die Siedlung eines Tirolds. Zwischen Fratersdorf<br />
und Dietzberg entstand, allerdings viel später, die Siedlung Poitmannsgrub. Im östlichen Teil der Gemeindeflur <strong>Zachenberg</strong><br />
entstand neben der Siedlung Gottlesried die Siedlung Göttleinsberg = Gözeleinsperg und im südlichsten Teil der<br />
Gemeinde die Siedlung <strong>Zachenberg</strong> = Zaccoperg und als weitere Siedlungen in dieser Gegend Bruckberg = Bruckhofperg,<br />
Ochsenberg = Weideberg, ebenso Gaißberg.<br />
Zu den ältesten Siedlungen zählen auch die im Tal gelegenen "bach"- und "hof"-Orte, nämlich Zierbach (Cyrwa), Auerbach<br />
und Brumbach. "hof"-Orte sind hier Wandlhof, Bruckhof, Auhof. Im Zusammenhang mit den Hofgründungen in dem ganzen<br />
hiesigen Waldgebiete stand in jener Zeit die starke Vermehrung der Mühlen. Fast jeder große Hof, der an einem fließenden<br />
Wasser oder in dessen Nähe war, erhielt seine eigene Mühle, z. B. Bruckhof = Bruckmühle, Wandlhof = Wandlmühle. Der<br />
große Wasserreichtum in den früheren Jahrhunderten hat zur Anlage der zahlreichen Mühlen geführt. In den alten <strong>Zachenberg</strong>er<br />
Urkunden ist vielfach die Rede <strong>von</strong> den "Viermühlen" des Wandlbachtales. Diese waren die Hausermühle, die Reisachmühle,<br />
die Stömmermühle und die Wandlmühle. Die letzteren 2 Mühlen sind die älteren <strong>von</strong> den 4 genannten Mühlen.<br />
Die späteren Mühlen hatten wie die Tavernen nur einen kleinen Hoffuß, z. B. die Reisachmühle (Reiser, Reisig, Busch) und<br />
die Hausermühle (Hauser = ein Familienname).<br />
Eine alte Siedlung ganz im Osten der Gemeindeflur <strong>Zachenberg</strong> am Fuße des Bartenstein ist Furth, eine seichte Stelle des<br />
Habischriederbaches, der <strong>von</strong> Habischried herunter Zeuserbach, dann <strong>von</strong> Hausermühle weg Hausermühlbach und <strong>von</strong> der<br />
Pommetsauermühle weg Friedbach heißt, und der bei der Raithmühle bei Regen in die Ohe mündet. Zu den späteren Gründungen<br />
in dieser Gegend gehören noch Gaisruck, Leuthen (Leitten) und Kirchweg (Kirchenweg).<br />
Vom Wandlhof aus rodete eine Sippe unter Führung eines Hadubet (abgekürzt: Haw = Hawenried oder Hafenried, auch<br />
Hawa = Hawaleuthen = Haberleuthen). Um das Jahr 1100 herum entstanden die beiden Siedlungen Viechtach und Regen.<br />
Viechtach wurde im Jahre 1272 <strong>von</strong> dem bayerischen Herzog Ludwig dem Strengen verkauft und bekam um das 1360 herum<br />
die Marktgerechtigkeit. Viechtach war Sitz eines Gerichtes. Die ganze Gemeinde <strong>Zachenberg</strong> gehörte damals zu diesem<br />
Landgericht. Die Ortschaft Regen dürfte etwa um das Jahr 1070 vom Kloster Rinchnach/Niederalteich aus gegründet worden<br />
sein und besaß wie ja auch Böbrach das Schergenamt.<br />
4. <strong>Zachenberg</strong> unter der Herrschaft des Kloster Gotteszell*<br />
1242 starb das mächtige Grafengeschlecht der Grafen <strong>von</strong> Bogen aus. Ludmilla, die junge Witwe des Grafen Adalbert <strong>von</strong><br />
Bogen, heiratete nach dessen Tod den bayerischen Herzog Ludwig I. den Kelheimer, der 1231 ermordet wurde. Dieser erbte<br />
nach Ableben des letzten Bogener Grafen den ganzen Bogener Besitz und damit auch den Wald- und Siedlungsbesitz im<br />
Donaugau und auch im Nordgau. Die Wittelsbacher gaben die Grafschaften, <strong>von</strong> denen sie außer Bogen noch mehrere bekamen,<br />
nicht mehr durch Belehnung in den Erbbesitz anderer Adeliger, sondern organisierten ihren viel größer gewordenen<br />
Staat durch Einteilung in 4 Viztumämter und diese wieder in kleinere Ämter. An der Spitze dieser Ämter stand ein Beamter.<br />
Viechtach stand damals unter dem Viztumamte Straubing.<br />
Eine Rodungs- und Siedlungstätigkeit war hier für die Herzöge nicht mehr veranlasst, da ja die Besiedlung ohnehin schon<br />
sehr dicht war. Wohl entstanden mit zunehmender Bevölkerungsdichte in den einzelnen Siedlungen neue Siedlungshäuser,<br />
aber neue Siedlungsorte wurden nicht gegründet. Daran änderte auch die Entstehung des Klosters Gotteszell nichts. 1205<br />
hatte Graf Heinrich <strong>von</strong> Pfelling dem Zisterzienserkloster Aldersbach seine Villa Droßlach geschenkt mit der Bedingung, diesen<br />
Ort mit 2 Priestern zu besetzen, bis die Einkünfte sich gemehrt hätten.<br />
Nachdem 1260 auch Pfelling und andere Güter, sowie der Zehent in Geiersthal hinzugekommen sind, begann man 1285 8<br />
das Kloster Gotteszell zu bauen. 1297 waren in diesem Kloster schon 13 Mönche. An Georgi 1320 wurde das Kloster Gotteszell<br />
zur Prälatur erhoben und erlebte einen immer größeren Aufschwung. Die Äbte der folgenden Zeit waren ständig bemüht<br />
durch Gütererwerbungen und Zehentankäufe, durch Privilegien und Jahrtagsstiftungen der Nussberger und Degenberger<br />
und anderer die Einkünfte des Klosters Gotteszell zu mehren.<br />
Zum Roden gab es nicht mehr viel. Die Rodungstätigkeit der Zisterzienser in Gotteszell unterschied sich nicht <strong>von</strong> der Rodungstätigkeit<br />
der privaten Grundbesitzer dieser Zeit. Sie erstreckte sich auf verhältnismäßig kleine Waldteile und diente in<br />
erster Linie der Gewinnung <strong>von</strong> neuen Fluren in nächster Nähe des Klosters, nicht aber <strong>von</strong> Siedlungsland. Dabei wurden<br />
zunächst die Wiesen verbessert und die Waldböden für den Weidebetrieb aufgeschlossen. Daraus ist ersichtlich, dass im<br />
Droßlacherhof hauptsächlich Viehzucht betrieben wurde und dass der Getreidebau damals noch wenig entwickelt war. Das<br />
kann man auch daraus entnehmen, dass mit wenigen Ausnahmen in dieser Zeit eine Rede wäre <strong>von</strong> Getreidegülten, höchstens<br />
<strong>von</strong> größeren Gütern in fruchtbarer Lage, z. B. Zuckenried und da auch nur <strong>von</strong> der Ablieferung <strong>von</strong> Hafer.<br />
Im Übrigen beschränkt sich die landwirtschaftliche Kulturarbeit des Klosters Gotteszell auf die nächste Umgebung des<br />
Klosterbesitzes. Nicht einmal der an das Klosterhofgut unmittelbar angrenzende, im Jahre 1385 erworbene Auhof wurde mit<br />
der Eigenwirtschaft vereinigt, sondern einem zinspflichtigen Nutznießer überlassen. Um die Ausdehnung des selbst bewirt-<br />
��� PRO AU H GW III �