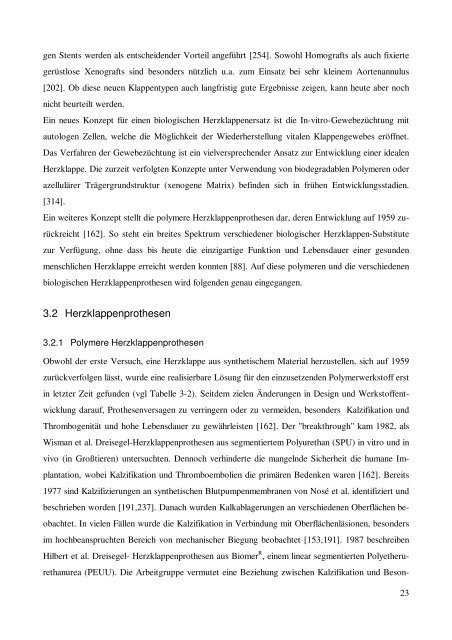Thesis - RWTH Aachen University
Thesis - RWTH Aachen University
Thesis - RWTH Aachen University
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
gen Stents werden als entscheidender Vorteil angeführt [254]. Sowohl Homografts als auch fixierte<br />
gerüstlose Xenografts sind besonders nützlich u.a. zum Einsatz bei sehr kleinem Aortenannulus<br />
[202]. Ob diese neuen Klappentypen auch langfristig gute Ergebnisse zeigen, kann heute aber noch<br />
nicht beurteilt werden.<br />
Ein neues Konzept für einen biologischen Herzklappenersatz ist die In-vitro-Gewebezüchtung mit<br />
autologen Zellen, welche die Möglichkeit der Wiederherstellung vitalen Klappengewebes eröffnet.<br />
Das Verfahren der Gewebezüchtung ist ein vielversprechender Ansatz zur Entwicklung einer idealen<br />
Herzklappe. Die zurzeit verfolgten Konzepte unter Verwendung von biodegradablen Polymeren oder<br />
azellulärer Trägergrundstruktur (xenogene Matrix) befinden sich in frühen Entwicklungsstadien.<br />
[314].<br />
Ein weiteres Konzept stellt die polymere Herzklappenprothesen dar, deren Entwicklung auf 1959 zu-<br />
rückreicht [162]. So steht ein breites Spektrum verschiedener biologischer Herzklappen-Substitute<br />
zur Verfügung, ohne dass bis heute die einzigartige Funktion und Lebensdauer einer gesunden<br />
menschlichen Herzklappe erreicht werden konnten [88]. Auf diese polymeren und die verschiedenen<br />
biologischen Herzklappenprothesen wird folgenden genau eingegangen.<br />
3.2 Herzklappenprothesen<br />
3.2.1 Polymere Herzklappenprothesen<br />
Obwohl der erste Versuch, eine Herzklappe aus synthetischem Material herzustellen, sich auf 1959<br />
zurückverfolgen lässt, wurde eine realisierbare Lösung für den einzusetzenden Polymerwerkstoff erst<br />
in letzter Zeit gefunden (vgl Tabelle 3-2). Seitdem zielen Änderungen in Design und Werkstoffent-<br />
wicklung darauf, Prothesenversagen zu verringern oder zu vermeiden, besonders Kalzifikation und<br />
Thrombogenität und hohe Lebensdauer zu gewährleisten [162]. Der "breakthrough" kam 1982, als<br />
Wisman et al. Dreisegel-Herzklappenprothesen aus segmentiertem Polyurethan (SPU) in vitro und in<br />
vivo (in Großtieren) untersuchten. Dennoch verhinderte die mangelnde Sicherheit die humane Im-<br />
plantation, wobei Kalzifikation und Thromboembolien die primären Bedenken waren [162]. Bereits<br />
1977 sind Kalzifizierungen an synthetischen Blutpumpenmembranen von Nosé et al. identifiziert und<br />
beschrieben worden [191,237]. Danach wurden Kalkablagerungen an verschiedenen Oberflächen be-<br />
obachtet. In vielen Fällen wurde die Kalzifikation in Verbindung mit Oberflächenläsionen, besonders<br />
im hochbeanspruchten Bereich von mechanischer Biegung beobachtet [153,191]. 1987 beschreiben<br />
Hilbert et al. Dreisegel- Herzklappenprothesen aus Biomer R , einem linear segmentierten Polyetheru-<br />
rethanurea (PEUU). Die Arbeitgruppe vermutet eine Beziehung zwischen Kalzifikation und Beson-<br />
23