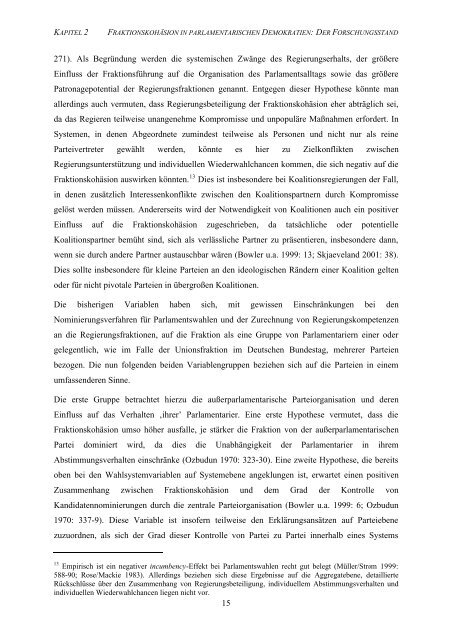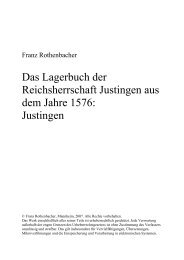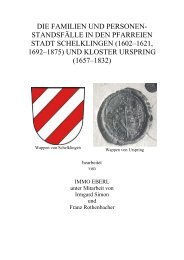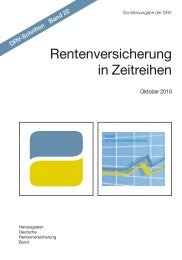Arbeit als PDF anzeigen - Mzes - Universität Mannheim
Arbeit als PDF anzeigen - Mzes - Universität Mannheim
Arbeit als PDF anzeigen - Mzes - Universität Mannheim
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
KAPITEL 2 FRAKTIONSKOHÄSION IN PARLAMENTARISCHEN DEMOKRATIEN: DER FORSCHUNGSSTAND<br />
271). Als Begründung werden die systemischen Zwänge des Regierungserhalts, der größere<br />
Einfluss der Fraktionsführung auf die Organisation des Parlamentsalltags sowie das größere<br />
Patronagepotential der Regierungsfraktionen genannt. Entgegen dieser Hypothese könnte man<br />
allerdings auch vermuten, dass Regierungsbeteiligung der Fraktionskohäsion eher abträglich sei,<br />
da das Regieren teilweise unangenehme Kompromisse und unpopuläre Maßnahmen erfordert. In<br />
Systemen, in denen Abgeordnete zumindest teilweise <strong>als</strong> Personen und nicht nur <strong>als</strong> reine<br />
Parteivertreter gewählt werden, könnte es hier zu Zielkonflikten zwischen<br />
Regierungsunterstützung und individuellen Wiederwahlchancen kommen, die sich negativ auf die<br />
Fraktionskohäsion auswirken könnten. 13 Dies ist insbesondere bei Koalitionsregierungen der Fall,<br />
in denen zusätzlich Interessenkonflikte zwischen den Koalitionspartnern durch Kompromisse<br />
gelöst werden müssen. Andererseits wird der Notwendigkeit von Koalitionen auch ein positiver<br />
Einfluss auf die Fraktionskohäsion zugeschrieben, da tatsächliche oder potentielle<br />
Koalitionspartner bemüht sind, sich <strong>als</strong> verlässliche Partner zu präsentieren, insbesondere dann,<br />
wenn sie durch andere Partner austauschbar wären (Bowler u.a. 1999: 13; Skjaeveland 2001: 38).<br />
Dies sollte insbesondere für kleine Parteien an den ideologischen Rändern einer Koalition gelten<br />
oder für nicht pivotale Parteien in übergroßen Koalitionen.<br />
Die bisherigen Variablen haben sich, mit gewissen Einschränkungen bei den<br />
Nominierungsverfahren für Parlamentswahlen und der Zurechnung von Regierungskompetenzen<br />
an die Regierungsfraktionen, auf die Fraktion <strong>als</strong> eine Gruppe von Parlamentariern einer oder<br />
gelegentlich, wie im Falle der Unionsfraktion im Deutschen Bundestag, mehrerer Parteien<br />
bezogen. Die nun folgenden beiden Variablengruppen beziehen sich auf die Parteien in einem<br />
umfassenderen Sinne.<br />
Die erste Gruppe betrachtet hierzu die außerparlamentarische Parteiorganisation und deren<br />
Einfluss auf das Verhalten ‚ihrer’ Parlamentarier. Eine erste Hypothese vermutet, dass die<br />
Fraktionskohäsion umso höher ausfalle, je stärker die Fraktion von der außerparlamentarischen<br />
Partei dominiert wird, da dies die Unabhängigkeit der Parlamentarier in ihrem<br />
Abstimmungsverhalten einschränke (Ozbudun 1970: 323-30). Eine zweite Hypothese, die bereits<br />
oben bei den Wahlsystemvariablen auf Systemebene angeklungen ist, erwartet einen positiven<br />
Zusammenhang zwischen Fraktionskohäsion und dem Grad der Kontrolle von<br />
Kandidatennominierungen durch die zentrale Parteiorganisation (Bowler u.a. 1999: 6; Ozbudun<br />
1970: 337-9). Diese Variable ist insofern teilweise den Erklärungsansätzen auf Parteiebene<br />
zuzuordnen, <strong>als</strong> sich der Grad dieser Kontrolle von Partei zu Partei innerhalb eines Systems<br />
13<br />
Empirisch ist ein negativer incumbency-Effekt bei Parlamentswahlen recht gut belegt (Müller/Strøm 1999:<br />
588-90; Rose/Mackie 1983). Allerdings beziehen sich diese Ergebnisse auf die Aggregatebene, detaillierte<br />
Rückschlüsse über den Zusammenhang von Regierungsbeteiligung, individuellem Abstimmungsverhalten und<br />
individuellen Wiederwahlchancen liegen nicht vor.<br />
15