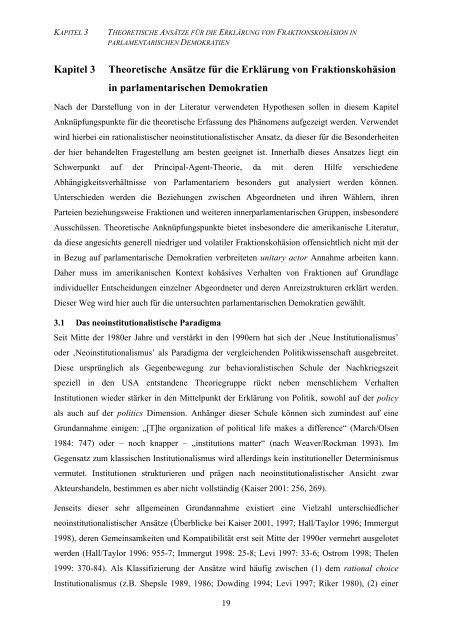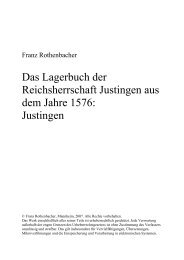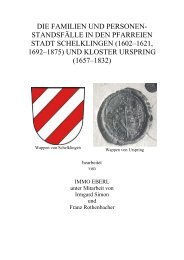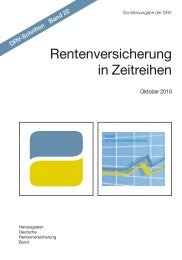Arbeit als PDF anzeigen - Mzes - Universität Mannheim
Arbeit als PDF anzeigen - Mzes - Universität Mannheim
Arbeit als PDF anzeigen - Mzes - Universität Mannheim
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
KAPITEL 3 THEORETISCHE ANSÄTZE FÜR DIE ERKLÄRUNG VON FRAKTIONSKOHÄSION IN<br />
PARLAMENTARISCHEN DEMOKRATIEN<br />
Kapitel 3 Theoretische Ansätze für die Erklärung von Fraktionskohäsion<br />
in parlamentarischen Demokratien<br />
Nach der Darstellung von in der Literatur verwendeten Hypothesen sollen in diesem Kapitel<br />
Anknüpfungspunkte für die theoretische Erfassung des Phänomens aufgezeigt werden. Verwendet<br />
wird hierbei ein rationalistischer neoinstitutionalistischer Ansatz, da dieser für die Besonderheiten<br />
der hier behandelten Fragestellung am besten geeignet ist. Innerhalb dieses Ansatzes liegt ein<br />
Schwerpunkt auf der Principal-Agent-Theorie, da mit deren Hilfe verschiedene<br />
Abhängigkeitsverhältnisse von Parlamentariern besonders gut analysiert werden können.<br />
Unterschieden werden die Beziehungen zwischen Abgeordneten und ihren Wählern, ihren<br />
Parteien beziehungsweise Fraktionen und weiteren innerparlamentarischen Gruppen, insbesondere<br />
Ausschüssen. Theoretische Anknüpfungspunkte bietet insbesondere die amerikanische Literatur,<br />
da diese angesichts generell niedriger und volatiler Fraktionskohäsion offensichtlich nicht mit der<br />
in Bezug auf parlamentarische Demokratien verbreiteten unitary actor Annahme arbeiten kann.<br />
Daher muss im amerikanischen Kontext kohäsives Verhalten von Fraktionen auf Grundlage<br />
individueller Entscheidungen einzelner Abgeordneter und deren Anreizstrukturen erklärt werden.<br />
Dieser Weg wird hier auch für die untersuchten parlamentarischen Demokratien gewählt.<br />
3.1 Das neoinstitutionalistische Paradigma<br />
Seit Mitte der 1980er Jahre und verstärkt in den 1990ern hat sich der ‚Neue Institutionalismus’<br />
oder ‚Neoinstitutionalismus’ <strong>als</strong> Paradigma der vergleichenden Politikwissenschaft ausgebreitet.<br />
Diese ursprünglich <strong>als</strong> Gegenbewegung zur behavioralistischen Schule der Nachkriegszeit<br />
speziell in den USA entstandene Theoriegruppe rückt neben menschlichem Verhalten<br />
Institutionen wieder stärker in den Mittelpunkt der Erklärung von Politik, sowohl auf der policy<br />
<strong>als</strong> auch auf der politics Dimension. Anhänger dieser Schule können sich zumindest auf eine<br />
Grundannahme einigen: „[T]he organization of political life makes a difference“ (March/Olsen<br />
1984: 747) oder – noch knapper – „institutions matter“ (nach Weaver/Rockman 1993). Im<br />
Gegensatz zum klassischen Institutionalismus wird allerdings kein institutioneller Determinismus<br />
vermutet. Institutionen strukturieren und prägen nach neoinstitutionalistischer Ansicht zwar<br />
Akteurshandeln, bestimmen es aber nicht vollständig (Kaiser 2001: 256, 269).<br />
Jenseits dieser sehr allgemeinen Grundannahme existiert eine Vielzahl unterschiedlicher<br />
neoinstitutionalistischer Ansätze (Überblicke bei Kaiser 2001, 1997; Hall/Taylor 1996; Immergut<br />
1998), deren Gemeinsamkeiten und Kompatibilität erst seit Mitte der 1990er vermehrt ausgelotet<br />
werden (Hall/Taylor 1996: 955-7; Immergut 1998: 25-8; Levi 1997: 33-6; Ostrom 1998; Thelen<br />
1999: 370-84). Als Klassifizierung der Ansätze wird häufig zwischen (1) dem rational choice<br />
Institutionalismus (z.B. Shepsle 1989, 1986; Dowding 1994; Levi 1997; Riker 1980), (2) einer<br />
19