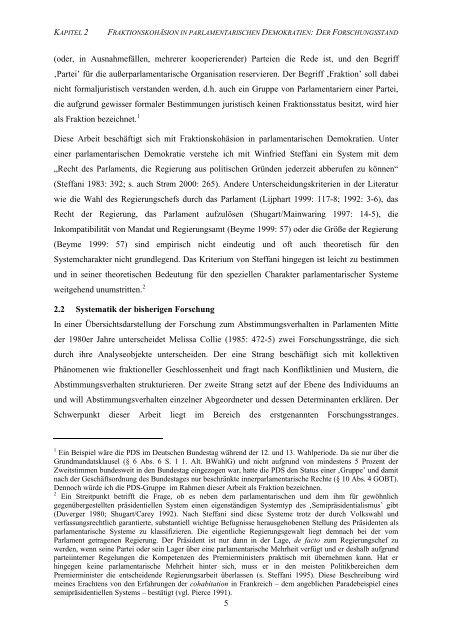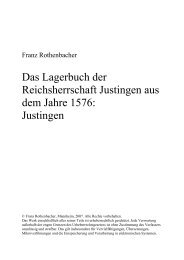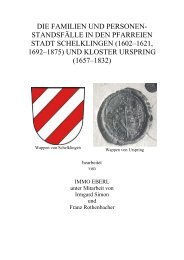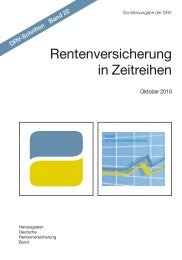Arbeit als PDF anzeigen - Mzes - Universität Mannheim
Arbeit als PDF anzeigen - Mzes - Universität Mannheim
Arbeit als PDF anzeigen - Mzes - Universität Mannheim
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
KAPITEL 2 FRAKTIONSKOHÄSION IN PARLAMENTARISCHEN DEMOKRATIEN: DER FORSCHUNGSSTAND<br />
(oder, in Ausnahmefällen, mehrerer kooperierender) Parteien die Rede ist, und den Begriff<br />
‚Partei’ für die außerparlamentarische Organisation reservieren. Der Begriff ‚Fraktion’ soll dabei<br />
nicht formaljuristisch verstanden werden, d.h. auch ein Gruppe von Parlamentariern einer Partei,<br />
die aufgrund gewisser formaler Bestimmungen juristisch keinen Fraktionsstatus besitzt, wird hier<br />
<strong>als</strong> Fraktion bezeichnet. 1<br />
Diese <strong>Arbeit</strong> beschäftigt sich mit Fraktionskohäsion in parlamentarischen Demokratien. Unter<br />
einer parlamentarischen Demokratie verstehe ich mit Winfried Steffani ein System mit dem<br />
„Recht des Parlaments, die Regierung aus politischen Gründen jederzeit abberufen zu können“<br />
(Steffani 1983: 392; s. auch Strøm 2000: 265). Andere Unterscheidungskriterien in der Literatur<br />
wie die Wahl des Regierungschefs durch das Parlament (Lijphart 1999: 117-8; 1992: 3-6), das<br />
Recht der Regierung, das Parlament aufzulösen (Shugart/Mainwaring 1997: 14-5), die<br />
Inkompatibilität von Mandat und Regierungsamt (Beyme 1999: 57) oder die Größe der Regierung<br />
(Beyme 1999: 57) sind empirisch nicht eindeutig und oft auch theoretisch für den<br />
Systemcharakter nicht grundlegend. Das Kriterium von Steffani hingegen ist leicht zu bestimmen<br />
und in seiner theoretischen Bedeutung für den speziellen Charakter parlamentarischer Systeme<br />
weitgehend unumstritten. 2<br />
2.2 Systematik der bisherigen Forschung<br />
In einer Übersichtsdarstellung der Forschung zum Abstimmungsverhalten in Parlamenten Mitte<br />
der 1980er Jahre unterscheidet Melissa Collie (1985: 472-5) zwei Forschungsstränge, die sich<br />
durch ihre Analyseobjekte unterscheiden. Der eine Strang beschäftigt sich mit kollektiven<br />
Phänomenen wie fraktioneller Geschlossenheit und fragt nach Konfliktlinien und Mustern, die<br />
Abstimmungsverhalten strukturieren. Der zweite Strang setzt auf der Ebene des Individuums an<br />
und will Abstimmungsverhalten einzelner Abgeordneter und dessen Determinanten erklären. Der<br />
Schwerpunkt dieser <strong>Arbeit</strong> liegt im Bereich des erstgenannten Forschungsstranges.<br />
1<br />
Ein Beispiel wäre die PDS im Deutschen Bundestag während der 12. und 13. Wahlperiode. Da sie nur über die<br />
Grundmandatsklausel (§ 6 Abs. 6 S. 1 1. Alt. BWahlG) und nicht aufgrund von mindestens 5 Prozent der<br />
Zweitstimmen bundesweit in den Bundestag eingezogen war, hatte die PDS den Status einer ‚Gruppe’ und damit<br />
nach der Geschäftsordnung des Bundestages nur beschränkte innerparlamentarische Rechte (§ 10 Abs. 4 GOBT).<br />
Dennoch würde ich die PDS-Gruppe im Rahmen dieser <strong>Arbeit</strong> <strong>als</strong> Fraktion bezeichnen.<br />
2<br />
Ein Streitpunkt betrifft die Frage, ob es neben dem parlamentarischen und dem ihm für gewöhnlich<br />
gegenübergestellten präsidentiellen System einen eigenständigen Systemtyp des ‚Semipräsidentialismus’ gibt<br />
(Duverger 1980; Shugart/Carey 1992). Nach Steffani sind diese Systeme trotz der durch Volkswahl und<br />
verfassungsrechtlich garantierte, substantiell wichtige Befugnisse herausgehobenen Stellung des Präsidenten <strong>als</strong><br />
parlamentarische Systeme zu klassifizieren. Die eigentliche Regierungsgewalt liegt demnach bei der vom<br />
Parlament getragenen Regierung. Der Präsident ist nur dann in der Lage, de facto zum Regierungschef zu<br />
werden, wenn seine Partei oder sein Lager über eine parlamentarische Mehrheit verfügt und er deshalb aufgrund<br />
parteiinterner Regelungen die Kompetenzen des Premierministers praktisch mit übernehmen kann. Hat er<br />
hingegen keine parlamentarische Mehrheit hinter sich, muss er in den meisten Politikbereichen dem<br />
Premierminister die entscheidende Regierungsarbeit überlassen (s. Steffani 1995). Diese Beschreibung wird<br />
meines Erachtens von den Erfahrungen der cohabitation in Frankreich – dem angeblichen Paradebeispiel eines<br />
semipräsidentiellen Systems – bestätigt (vgl. Pierce 1991).<br />
5