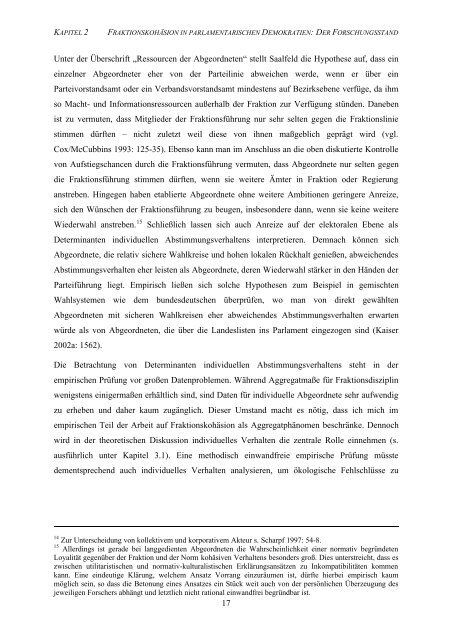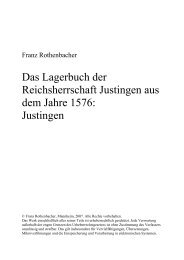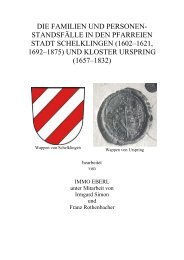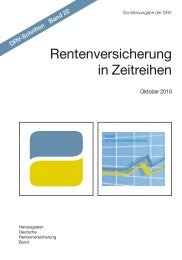Arbeit als PDF anzeigen - Mzes - Universität Mannheim
Arbeit als PDF anzeigen - Mzes - Universität Mannheim
Arbeit als PDF anzeigen - Mzes - Universität Mannheim
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
KAPITEL 2 FRAKTIONSKOHÄSION IN PARLAMENTARISCHEN DEMOKRATIEN: DER FORSCHUNGSSTAND<br />
Unter der Überschrift „Ressourcen der Abgeordneten“ stellt Saalfeld die Hypothese auf, dass ein<br />
einzelner Abgeordneter eher von der Parteilinie abweichen werde, wenn er über ein<br />
Parteivorstandsamt oder ein Verbandsvorstandsamt mindestens auf Bezirksebene verfüge, da ihm<br />
so Macht- und Informationsressourcen außerhalb der Fraktion zur Verfügung stünden. Daneben<br />
ist zu vermuten, dass Mitglieder der Fraktionsführung nur sehr selten gegen die Fraktionslinie<br />
stimmen dürften – nicht zuletzt weil diese von ihnen maßgeblich geprägt wird (vgl.<br />
Cox/McCubbins 1993: 125-35). Ebenso kann man im Anschluss an die oben diskutierte Kontrolle<br />
von Aufstiegschancen durch die Fraktionsführung vermuten, dass Abgeordnete nur selten gegen<br />
die Fraktionsführung stimmen dürften, wenn sie weitere Ämter in Fraktion oder Regierung<br />
anstreben. Hingegen haben etablierte Abgeordnete ohne weitere Ambitionen geringere Anreize,<br />
sich den Wünschen der Fraktionsführung zu beugen, insbesondere dann, wenn sie keine weitere<br />
Wiederwahl anstreben. 15 Schließlich lassen sich auch Anreize auf der elektoralen Ebene <strong>als</strong><br />
Determinanten individuellen Abstimmungsverhaltens interpretieren. Demnach können sich<br />
Abgeordnete, die relativ sichere Wahlkreise und hohen lokalen Rückhalt genießen, abweichendes<br />
Abstimmungsverhalten eher leisten <strong>als</strong> Abgeordnete, deren Wiederwahl stärker in den Händen der<br />
Parteiführung liegt. Empirisch ließen sich solche Hypothesen zum Beispiel in gemischten<br />
Wahlsystemen wie dem bundesdeutschen überprüfen, wo man von direkt gewählten<br />
Abgeordneten mit sicheren Wahlkreisen eher abweichendes Abstimmungsverhalten erwarten<br />
würde <strong>als</strong> von Abgeordneten, die über die Landeslisten ins Parlament eingezogen sind (Kaiser<br />
2002a: 1562).<br />
Die Betrachtung von Determinanten individuellen Abstimmungsverhaltens steht in der<br />
empirischen Prüfung vor großen Datenproblemen. Während Aggregatmaße für Fraktionsdisziplin<br />
wenigstens einigermaßen erhältlich sind, sind Daten für individuelle Abgeordnete sehr aufwendig<br />
zu erheben und daher kaum zugänglich. Dieser Umstand macht es nötig, dass ich mich im<br />
empirischen Teil der <strong>Arbeit</strong> auf Fraktionskohäsion <strong>als</strong> Aggregatphänomen beschränke. Dennoch<br />
wird in der theoretischen Diskussion individuelles Verhalten die zentrale Rolle einnehmen (s.<br />
ausführlich unter Kapitel 3.1). Eine methodisch einwandfreie empirische Prüfung müsste<br />
dementsprechend auch individuelles Verhalten analysieren, um ökologische Fehlschlüsse zu<br />
14<br />
Zur Unterscheidung von kollektivem und korporativem Akteur s. Scharpf 1997: 54-8.<br />
15<br />
Allerdings ist gerade bei langgedienten Abgeordneten die Wahrscheinlichkeit einer normativ begründeten<br />
Loyalität gegenüber der Fraktion und der Norm kohäsiven Verhaltens besonders groß. Dies unterstreicht, dass es<br />
zwischen utilitaristischen und normativ-kulturalistischen Erklärungsansätzen zu Inkompatibilitäten kommen<br />
kann. Eine eindeutige Klärung, welchem Ansatz Vorrang einzuräumen ist, dürfte hierbei empirisch kaum<br />
möglich sein, so dass die Betonung eines Ansatzes ein Stück weit auch von der persönlichen Überzeugung des<br />
jeweiligen Forschers abhängt und letztlich nicht rational einwandfrei begründbar ist.<br />
17