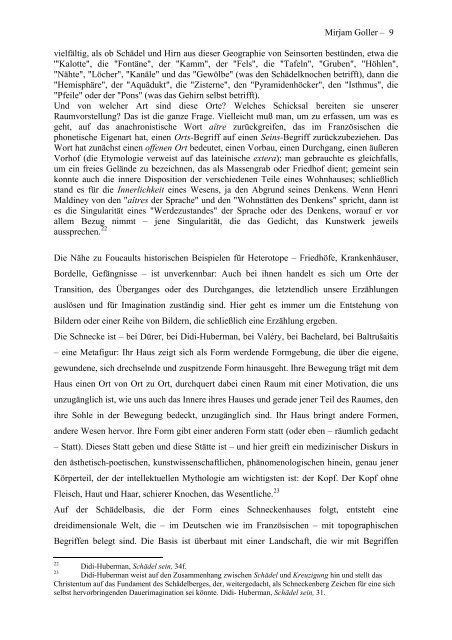[erscheint in: Poesie intermedial - Anselmo Fox
[erscheint in: Poesie intermedial - Anselmo Fox
[erscheint in: Poesie intermedial - Anselmo Fox
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Mirjam Goller – 9<br />
vielfältig, als ob Schädel und Hirn aus dieser Geographie von Se<strong>in</strong>sorten bestünden, etwa die<br />
'"Kalotte", die "Fontäne", der "Kamm", der "Fels", die "Tafeln", "Gruben", "Höhlen",<br />
"Nähte", "Löcher", "Kanäle" und das "Gewölbe" (was den Schädelknochen betrifft), dann die<br />
"Hemisphäre", der "Aquädukt", die "Zisterne", den "Pyramidenhöcker", den "Isthmus", die<br />
"Pfeile" oder der "Pons" (was das Gehirn selbst betrifft).<br />
Und von welcher Art s<strong>in</strong>d diese Orte? Welches Schicksal bereiten sie unserer<br />
Raumvorstellung? Das ist die ganze Frage. Vielleicht muß man, um zu erfassen, um was es<br />
geht, auf das anachronistische Wort aître zurückgreifen, das im Französischen die<br />
phonetische Eigenart hat, e<strong>in</strong>en Orts-Begriff auf e<strong>in</strong>en Se<strong>in</strong>s-Begriff zurückzubeziehen. Das<br />
Wort hat zunächst e<strong>in</strong>en offenen Ort bedeutet, e<strong>in</strong>en Vorbau, e<strong>in</strong>en Durchgang, e<strong>in</strong>en äußeren<br />
Vorhof (die Etymologie verweist auf das late<strong>in</strong>ische extera); man gebrauchte es gleichfalls,<br />
um e<strong>in</strong> freies Gelände zu bezeichnen, das als Massengrab oder Friedhof dient; geme<strong>in</strong>t se<strong>in</strong><br />
konnte auch die <strong>in</strong>nere Disposition der verschiedenen Teile e<strong>in</strong>es Wohnhauses; schließlich<br />
stand es für die Innerlichkeit e<strong>in</strong>es Wesens, ja den Abgrund se<strong>in</strong>es Denkens. Wenn Henri<br />
Mald<strong>in</strong>ey von den "aîtres der Sprache" und den "Wohnstätten des Denkens" spricht, dann ist<br />
es die S<strong>in</strong>gularität e<strong>in</strong>es "Werdezustandes" der Sprache oder des Denkens, worauf er vor<br />
allem Bezug nimmt – jene S<strong>in</strong>gularität, die das Gedicht, das Kunstwerk jeweils<br />
aussprechen. 22<br />
Die Nähe zu Foucaults historischen Beispielen für Heterotope – Friedhöfe, Krankenhäuser,<br />
Bordelle, Gefängnisse – ist unverkennbar: Auch bei ihnen handelt es sich um Orte der<br />
Transition, des Überganges oder des Durchganges, die letztendlich unsere Erzählungen<br />
auslösen und für Imag<strong>in</strong>ation zuständig s<strong>in</strong>d. Hier geht es immer um die Entstehung von<br />
Bildern oder e<strong>in</strong>er Reihe von Bildern, die schließlich e<strong>in</strong>e Erzählung ergeben.<br />
Die Schnecke ist – bei Dürer, bei Didi-Huberman, bei Valéry, bei Bachelard, bei Baltrušaitis<br />
– e<strong>in</strong>e Metafigur: Ihr Haus zeigt sich als Form werdende Formgebung, die über die eigene,<br />
gewundene, sich drechselnde und zuspitzende Form h<strong>in</strong>ausgeht. Ihre Bewegung trägt mit dem<br />
Haus e<strong>in</strong>en Ort von Ort zu Ort, durchquert dabei e<strong>in</strong>en Raum mit e<strong>in</strong>er Motivation, die uns<br />
unzugänglich ist, wie uns auch das Innere ihres Hauses und gerade jener Teil des Raumes, den<br />
ihre Sohle <strong>in</strong> der Bewegung bedeckt, unzugänglich s<strong>in</strong>d. Ihr Haus br<strong>in</strong>gt andere Formen,<br />
andere Wesen hervor. Ihre Form gibt e<strong>in</strong>er anderen Form statt (oder eben – räumlich gedacht<br />
– Statt). Dieses Statt geben und diese Stätte ist – und hier greift e<strong>in</strong> mediz<strong>in</strong>ischer Diskurs <strong>in</strong><br />
den ästhetisch-poetischen, kunstwissenschaftlichen, phänomenologischen h<strong>in</strong>e<strong>in</strong>, genau jener<br />
Körperteil, der der <strong>in</strong>tellektuellen Mythologie am wichtigsten ist: der Kopf. Der Kopf ohne<br />
Fleisch, Haut und Haar, schierer Knochen, das Wesentliche. 23<br />
Auf der Schädelbasis, die der Form e<strong>in</strong>es Schneckenhauses folgt, entsteht e<strong>in</strong>e<br />
dreidimensionale Welt, die – im Deutschen wie im Französischen – mit topographischen<br />
Begriffen belegt s<strong>in</strong>d. Die Basis ist überbaut mit e<strong>in</strong>er Landschaft, die wir mit Begriffen<br />
22 Didi-Huberman, Schädel se<strong>in</strong>, 34f.<br />
23 Didi-Huberman weist auf den Zusammenhang zwischen Schädel und Kreuzigung h<strong>in</strong> und stellt das<br />
Christentum auf das Fundament des Schädelberges, der, weitergedacht, als Schneckenberg Zeichen für e<strong>in</strong>e sich<br />
selbst hervorbr<strong>in</strong>genden Dauerimag<strong>in</strong>ation sei könnte. Didi- Huberman, Schädel se<strong>in</strong>, 31.