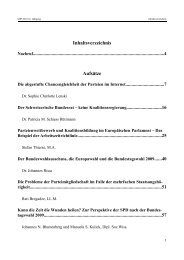Download - PRuF
Download - PRuF
Download - PRuF
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Aufsätze Philipp Erbentraut - Radikaldemokratisches Denken im Vormärz: zur Aktualität der Parteientheorie Julius Fröbels<br />
MIP 2008/09 15. Jhrg.<br />
Die Frage ist nun, wie sich diese erheblichen<br />
Widersprüche ins Konstruktive wenden lassen.<br />
Dazu schlage ich vor, über Fröbels Parteientheorie<br />
hinauszugehen und seine radikaldemokratischen<br />
Ideale als Denkanstoß für ein institutionelles<br />
Reformprojekt des bestehenden politischen<br />
Systems in Deutschland zu nutzen, das dem Postulat<br />
staatsbürgerlicher Selbstbestimmung gerecht<br />
wird, mehr Entscheidungskompetenzen an<br />
der Basis bündelt und somit zugleich auf die seit<br />
Jahren massiv geübte Kritik an den politischen<br />
Parteien in der Bundesrepublik 70 reagiert. Dabei<br />
kann es natürlich nicht darum gehen, die von<br />
Fröbel für das 19. Jahrhundert ausbuchstabierten<br />
Lösungen ohne Umstand auf die heute völlig<br />
veränderten gesellschaftlichen Verhältnisse zu<br />
übertragen. Man muss aber nach den Ideen und<br />
Grundüberzeugungen fahnden, die den damaligen<br />
Optionen zu Grunde lagen. Genau wie<br />
Rousseau hat Fröbel im Namen der Volkssouveränität<br />
ein striktes Autonomiekonzept verfochten.<br />
Anders als die Rousseau-Kritik im Anschluss<br />
an Carl Schmitt behauptet, ging es bei<br />
dieser Form „identitärer Demokratie“ aber niemals<br />
um die „Identität von Herrschenden und<br />
Beherrschten“ 71 , sondern um die Identität von<br />
Gesetzgebenden und Gesetzesadressaten 72 . Hier<br />
wäre der Hebel anzusetzen, indem man die Bürger<br />
daran erinnert, nur diejenigen Gesetze als le-<br />
70<br />
Zum Stand der normativen Debatte vgl.: ALEMANN, Ulrich<br />
von: Brauchen wir noch politische Parteien?, in:<br />
Peter Häberle u. a. (Hrsg.), Festschrift für Dimitris Th.<br />
Tsatsos zum 70. Geburtstag, Baden-Baden 2003. S. 1–<br />
10 sowie MORLOK, Martin: Lob der Parteien, in: Jahrbuch<br />
der Juristischen Gesellschaft Bremen, Bd. 2, Bremen<br />
2001. S. 53–75.<br />
71<br />
So immer noch KRIELE, Einführung in die Staatslehre,<br />
S. 237.<br />
72<br />
Rousseau weist ausdrücklich und von sich aus auf die<br />
Schwierigkeiten und Gefahren der Selbstregierung hin.<br />
Die Hindernisse sind aus seiner Sicht so groß, dass die<br />
demokratische Regierungsform „ein Volk von Göttern“<br />
erfordert. Vgl.: ROUSSEAU, Gesellschaftsvertrag, S. 74.<br />
An seinem generellen Plädoyer für die republikanische<br />
Staatsform ändert diese Einschätzung natürlich nichts.<br />
Eine Autorin, die diese Lesart seit Jahren energisch<br />
vertritt, ist die Frankfurter Politikwissenschaftlerin Ingeborg<br />
Maus. Vgl: MAUS, Ingeborg: Zur Aufklärung<br />
der Demokratietheorie: rechts- und demokratietheoretische<br />
Überlegungen im Anschluß an Kant, Frankfurt am<br />
Main 1994. S. 201.<br />
gitim anzuerkennen, die sie sich selbst gegeben<br />
haben.<br />
Herrschaft über Menschen abzubauen und durch<br />
die Selbstbestimmung des Individuums zu ersetzen,<br />
ist seit Karl Marx’ berühmter Beschreibung<br />
der Pariser Kommune auch der Grundgedanke<br />
aller rätedemokratischen Entwürfe. 73 Derartige<br />
Überlegungen sehen sich allerdings mit einer<br />
ganzen Reihe von teils vernünftigen Einwänden<br />
konfrontiert, die vor allem auf die generelle Organisationslogik<br />
des Rätesystems und negative<br />
historische Erfahrungen abheben. Der Blick in<br />
die Geschichte kann aber nicht an die Stelle systematischer<br />
Widerlegung treten. Zudem beziehen<br />
die erstgenannten Bedenken ihre Triftigkeit<br />
oft aus allgemeinen Strukturproblemen industrieller<br />
Gesellschaften und können deshalb in ähnlicher<br />
Weise auch gegenüber parlamentarischen<br />
Regierungssystemen in Stellung gebracht werden.<br />
74<br />
Abstrahiert man einmal vom Grundsatz des ursprünglich<br />
proletarischen Charakters der Basisorganisationen,<br />
lassen sich die immer wieder genannten<br />
Hauptelemente des Rätesystems – politische<br />
Willensbildung von unten nach oben, geringer<br />
Institutionalisierungsgrad der Parteien und<br />
Verbände, imperatives Mandat usw. – auch als<br />
Maßnahmenkatalog einer auf dem Prinzip der<br />
Volkssouveränität basierenden direkten Demokratie<br />
lesen. Was spräche eigentlich dagegen,<br />
das bestehende parlamentarische System, durch<br />
das Experiment einer „dezentralisierten Gesetzgebung“<br />
75 zu ergänzen, die sich anstelle der Betriebe<br />
als unterste Organisationseinheiten auf<br />
Stadtteilversammlungen und kommunale Ortschaftsräte<br />
stützt?<br />
In der Tat gab es in Teilen der deutschen Arbeiterbewegung<br />
bereits zu Beginn der Weimarer<br />
Republik Überlegungen, die Rätedemokratie mit<br />
dem parlamentarischen Repräsentativsystem zu<br />
versöhnen – zum Beispiel durch die Einrichtung<br />
73<br />
MARX, Karl: Der Bürgerkrieg in Frankreich (1871), in:<br />
MEW, Bd. 17, Berlin 1964. S. 313–362 (338ff.)<br />
74<br />
BERMBACH, Udo: Organisationsprobleme direkter Demokratie,<br />
in: Ders. (Hrsg.), Theorie und Praxis der direkten<br />
Demokratie. Texte und Materialien zur Räte-<br />
Diskussion, Opladen 1973. S. 13–32 (27).<br />
75<br />
MAUS, Zur Aufklärung..., S. 224.<br />
14