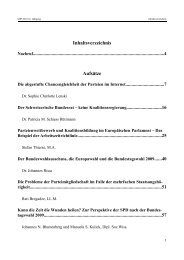Download - PRuF
Download - PRuF
Download - PRuF
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Aufsätze Marcus Hahn – Formalisierbare Gleichheit MIP 2008/09 15. Jhrg.<br />
lungsverfahrens ist der Grundsatz der Chancengleichheit<br />
bei der Wahlteilnahme, Art. 21,<br />
38 I 1 GG. Hieran wird das gesetzgeberisch ausgestaltete<br />
„Wahlsystem“ gemessen (1). Die verfassungsrechtliche<br />
Rechtfertigung setzt sich in<br />
der Überprüfung seiner inneren Stimmigkeit fort<br />
(2). Modifikationen sind dann ihrerseits rechtfertigungsbedürftig<br />
(3) (vgl. Rn. 48 ff.).<br />
Hier interessiert, ob die „Ein-Sitz-Klausel“ auf<br />
den Stufen (1) bzw. (2) anzusiedeln und somit<br />
Teil der gesetzgeberischen Systemausgestaltung<br />
war oder ob sie vielmehr eine erneut zu rechtfertigende<br />
Modifikation (3) darstellte. Dies macht<br />
die Abgrenzung zwischen Systemausgestaltung<br />
und Modifikation erforderlich. Zutreffend hat<br />
der VerfGH eine Modifikation erkannt (Rn. 47).<br />
Allerdings fällt die Begründung knapp aus und<br />
kann durch eine vertiefte Abgrenzung unterstützt<br />
werden.<br />
Ein Versuch hierzu soll im Folgenden vor dem<br />
Hintergrund der Wahlgleichheit mit Hilfe mathematischer<br />
Erkenntnisse unternommen werden.<br />
Abschließen soll die Besprechung mit der These,<br />
dass sich die Ausgestaltung formaler Wahlrechtsgleichheit<br />
neben normativer auch auf „formalisierbare<br />
Gleichheit“ stützt.<br />
II. Chancengleichheit bei der Wahlteilnahme<br />
und Erfolgswertverschiebungen<br />
Die Chancengleichheit der politischen Parteien<br />
auf Sitzzuteilung ist eine Konkretisierung der<br />
allgemeinen Wahlgleichheit (Art. 20 I, 28 I 2,<br />
38 I 1 GG). Im Vorfeld der Wahl folgt hieraus<br />
eine unabdingbare Chancengleichheit der Parteien<br />
im Hinblick auf die Wahlvorbereitung 5 und<br />
den anschließenden Wahlakt. Eine konsequente<br />
Erweiterung bildet die fraktionelle Gleichheit im<br />
Parlament 6 . Es besteht eine enge Verbindung mit<br />
den Prinzipien der Demokratie und Volkssouve-<br />
5<br />
Beispiele: BVerfG NJW 2002, 2939; hierzu H. Bethge,<br />
ZUM 2003, 253 ff. (Kandidatenduell); K. Stumper,<br />
ZUM 1994, 98 ff. m.w.N. (Rundfunk). Vgl. hierzu<br />
auch C. Gusy, AK-GG, Art. 21 Rn. 91 ff. Zur Herleitung<br />
durch Grundrechtssynthesen M. Meinke, In Verbindung<br />
Mit, 2006, S. 134-143.<br />
6<br />
Vorausschauend H. Triepel, Die Staatsverfassung der<br />
politischen Parteien, 2.A. 1930, S.14-18, 20; BVerfGE<br />
10, 4 (14); 84, 304 (322 ff.), 96, 264 (279 ff.).<br />
ränität sowie der Funktion der politischen Parteien,<br />
aus dem Volk heraus und prinzipiell ungebunden<br />
die politische Willensbildung im Volk in<br />
ein zu wählendes Parlament zu transformieren 7 .<br />
Die Gewährleistung gleicher und unbeschränkter<br />
Wahlteilnahme ist wesentlicher Teil der Erfüllung<br />
dieser Funktion der Parteien 8 .<br />
Parteien-, Wahl- und Parlamentsrecht sind Wettbewerbsrecht<br />
mit formaler Gleichheit auf verschiedenen<br />
zeitlichen und räumlichen Stufen 9 .<br />
Tragend sind daher ein durchgehender, diesen<br />
Stufen angepasster, aber gleichbleibend strenger<br />
Gleichheitsgrundsatz und die Neutralität des<br />
Staates, verstanden als Identifikationsverbot 10 .<br />
1. Mathematische Gleichheit von Zählwert<br />
und Gewichtung der Stimmen<br />
Konsequent haben dann der Wahlakt und die<br />
Gewichtung der Stimmen einem strengen<br />
Gleichheitsmaßstab zu folgen. Im Hinblick auf<br />
Auszählung und Gewichtung der Stimmen ist<br />
dieser Maßstab mathematisch-formal zu verstehen<br />
11 . Unstreitig genießt jede Stimme daher den<br />
gleichen Zählwert 12 . Die kontroverse Frage, ob<br />
auch ein gleicher Erfolgswert oder nur eine „Erfolgschancengleichheit“<br />
in Relation zum gesetzgeberisch<br />
ausgestalteten Wahlsystem 13 aus dem<br />
7<br />
D. Grimm, Politische Parteien, in: E. Benda/W.<br />
Maihofer/H.-J. Vogel (Hrsg.), Handbuch des Verfassungsrechts<br />
der Bundesrepublik Deutschland, § 14 Rn.<br />
6, 54 ff.<br />
8<br />
D. Grimm, ebd., § 14 Rn. 15. Vgl. auch H. M. Heinig/<br />
M. Morlok, Konkurrenz belebt das Geschäft, ZG 2000,<br />
371 (371).<br />
9<br />
Vgl. H. M. Heinig/M. Morlok, ZG 2000, 371 (372 f.);<br />
weiterhin M. Morlok, in: Dreier, GG, Art. 38 Rn. 94 ff.<br />
Ferner N. Achterberg/M. Schulte, MKS, GG, Art. 38<br />
Rn. 130-132; C. Gusy, AK-GG, Art. 21 Rn. 88 f.<br />
10<br />
Hierzu U. Volkmann, BerlKomm GG, Art. 21 Rn. 50<br />
ff.<br />
11<br />
BVerfGE 51, 222 (234); 85, 264 (315); M/D-Klein,<br />
GG, Art. 38 Rn. 115.<br />
12<br />
Allg. A., statt aller M/D-Klein, GG, Art. 38 Rn. 120;<br />
13<br />
So M/D-Klein, GG, Art. 38 Rn. 120 mit Verweis auf<br />
BVerfGE 95, 335 (353 f.) und die st. Rspr. des<br />
BVerfG, die die Erfolgswertgleichheit jedenfalls für<br />
das Verhältniswahlsystem bejaht, zuletzt BVerfG<br />
DVBl. 2008, 1045 (1047). Für eine unbedingte Erfolgswertgleichheit<br />
aber mit gewichtigen Argumenten<br />
42