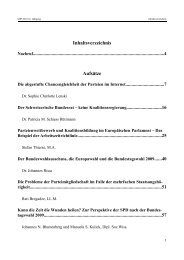Download - PRuF
Download - PRuF
Download - PRuF
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Aufsätze Marcus Hahn – Formalisierbare Gleichheit MIP 2008/09 15. Jhrg.<br />
dieses zweitens mathematisch formalisierbar.<br />
Dementsprechend sind Systemausgestaltung und<br />
Modifikation abgrenzbar. Die dritte Stufe ist die<br />
normative Rechtfertigung der Modifikation.<br />
Rechtfertigungsgründe liegen außerhalb der Mathematik<br />
– sie können allein aus dem bisherigen<br />
Bestand von Rechtsdogmatik und Rechtsprechung<br />
heraus kreiert werden. Die erste Stufe ist<br />
ein formaler, die zweite Stufe ein Prozess nicht<br />
formalisierbarer Kohärenzschaffung 48 .<br />
IV. Ausblick: Formalisierbare Gleichheit<br />
Gleichheit im Wahlrecht ist im Hinblick auf das<br />
Mandatszuteilungsverfahren nicht nur formal,<br />
sondern auch rechnerisch formalisierbar. Die<br />
Annahme einer „formalisierbaren Gleichheit“<br />
spitzt das formale Gleichheitsverständnis der<br />
Mandatszuteilung mathematisch zu und könnte<br />
daher auf Einwände stoßen.<br />
1. Mögliche Einwände<br />
Der Einwand, diese Methode, einen Gleichheitsverstoß<br />
festzustellen, sei mechanistisch und normativen<br />
Wertungen unzugänglich, kann durch<br />
Verweis auf die Rechtfertigungsebene entkräftet<br />
werden. Sobald es nicht mehr um mathematisierbare<br />
Größen geht, bleibt die Rechtfertigung einer<br />
solchen Ungleichbehandlung wertungsabhängig.<br />
Schwerer wiegt der Einwand, dass „kalte“ und<br />
inhaltsleere Mathematik nicht die staatstheoretischen<br />
und geistesgeschichtlichen Grundlagen einer<br />
Verfassung, wie etwa demokratische Repräsentation,<br />
wiedergebe 49 . Dies ist grundsätzlich<br />
richtig, jedoch ist die Formalisierbarkeit eines<br />
Mandatszuteilungsverfahrens abhängig von dem<br />
jeweiligen Wahlsystem, das insgesamt an der<br />
Verfassung in Einklang mit ihren Konkretisierungen<br />
zu rechtfertigen ist. Formalisierbarkeit ist<br />
48<br />
Vgl. K. I. Lee, Die Struktur der juristischen Entscheidung<br />
aus konstruktivistischer Sicht, Diss. iur. Düsseldorf<br />
2008, Teil 2 Abschnitt VI., mit vertiefenden<br />
Nachweisen, i. E.<br />
49<br />
J. Krüper, NWVBl. 2005, 97 (98). Grundlegend zum<br />
Begriff der Repräsentation G. Leibholz, Das Wesen der<br />
Repräsentation (1928) und der Gestaltwandel der Demokratie<br />
im 20. Jahrhundert (1960), 2. Auflage, Berlin<br />
1960, S. 26 ff.<br />
somit deklaratorisch und nicht konstitutiv für die<br />
Konkretisierung von Gleichheitssätzen. Etwa in<br />
politischen Aushandlungsprozessen, wie Koalitionen<br />
und Ausschussbesetzungen, endet ihre<br />
Überzeugungskraft 50 . Dennoch hat sie eine<br />
Scharnierfunktion: sie ist Ausdruck und Ausgangspunkt<br />
innerer Folgerichtigkeit der gesetzgeberischen<br />
Verfassungsinterpretation 51 .<br />
Daher steht das Postulat formalisierbarer Gleichheit<br />
auch im Einklang mit Geschichtsbedingtheit<br />
52 , Wandel 53 und Wirklichkeitsbezug 54 des<br />
Parteien- und Wahlrechts: verliert die Formalisierung<br />
ihre Rechtfertigung, kann sie nicht mehr<br />
einen verfassungsrechtlich legitimen Gleichheitssatz<br />
abbilden und muss ersetzt werden. Sie<br />
ist zeitlich gebundenes Abbild der Wahlrechtsgleichheit.<br />
2. Anwendung als übergreifendes Rechtskriterium<br />
und Grenzen<br />
„Formalisierbare Gleichheit“ ist genau und nur<br />
dort ein dogmatisches Kriterium, wo formale<br />
Gleichheitssätze gelten und Begünstigungen<br />
quantitativ messbar sind. Damit ist sie kein generelles<br />
Kriterium des öffentlichen Rechts – aber<br />
dennoch relevant: zu denken ist an das Steuerrecht<br />
55 oder staatliche Leistungen 56 . Hier ist<br />
ebenfalls eine neutrale Formalisierbarkeit zwischen<br />
verfassungsgemäßer Systementscheidung<br />
und Rechtfertigung von Modifikationen gegeben.<br />
Wegen dieser Möglichkeit und des Bedürfnisses<br />
zu einer normativen Rechtfertigung wird hiermit<br />
kein formalistisches Gleichheitsverständnis be-<br />
50<br />
Zutreffend J. Krüper, ebd.<br />
51<br />
Hierzu M. Herdegen, Verfassungsinterpretation als<br />
methodische Disziplin, JZ 2004, 873 (875).<br />
52<br />
Siehe M. Heinig, MIP 1999, 25 (26). Grundlegend<br />
Triepel (Fn. 6).<br />
53<br />
N. Achterberg/M. Schulte, MKS, GG, Art. 38 Rn. 138.<br />
54<br />
Grundlegend K. Hesse, Die verfassungsrechtliche<br />
Stellung der politischen Parteien im modernen Staat,<br />
VVDStRL 17 (1959), S. 11 (13 f.); M/D-Klein, Art. 38<br />
Rn. 158 f.<br />
55<br />
BVerfGE 84, 239 (282); 93, 121 (134); 110, 94 (112).<br />
56<br />
Vgl. BSG GesR 2007, 581 ff. oder die<br />
„Rentenformel“ in § 68 V SGB VI.<br />
48