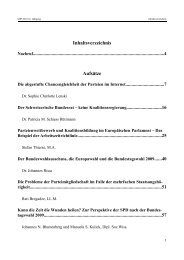Download - PRuF
Download - PRuF
Download - PRuF
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Aufsätze Philipp Erbentraut - Radikaldemokratisches Denken im Vormärz: zur Aktualität der Parteientheorie Julius Fröbels<br />
MIP 2008/09 15. Jhrg.<br />
II. Allgemeine Parteientheorie des Vormärz<br />
Bekanntermaßen zählt das Wort „Partei“ 20 zu jenen<br />
Begriffen, die – und zwar relativ unabhängig<br />
vom jeweiligen politischen Standpunkt des Betrachters<br />
aus – ungewöhnlich lange negativ konnotiert<br />
waren. 21 Antike Gemeinwohl- und Ordnungsvorstellungen<br />
sowie mittelalterliche Concordia-Lehren<br />
wirkten bis tief in die Neuzeit hinein<br />
und ließen wenig Spielraum für eine positive<br />
Bewertung des Parteienwesens. Klaus von Beyme<br />
hat in diesem Zusammenhang treffend von<br />
der „Geschichte eines diskriminierenden Begriffs“<br />
22 gesprochen. Erst im 18. Jahrhundert – in<br />
England bereits etwas früher – taucht das Wort<br />
in Korrelation zum Entwicklungsstand des Parlamentarismus<br />
zunehmend auch in positiver Bedeutung<br />
auf 23 , während der Begriff „Faktion“<br />
weiterhin negativ besetzt bleibt. Madison verwendet<br />
im berühmten 10. Artikel der Federalist<br />
Papers beide Begriffe noch synonym und in denunziatorischer<br />
Absicht. 24 Auch in der Französischen<br />
Revolution haben die Parteien keine Lobby,<br />
da sie ganz überwiegend als Gegensatz zu<br />
der von Rousseau propagierten volonté générale<br />
begriffen werden. 25<br />
20<br />
Gemeint ist im Folgenden ausschließlich die politische<br />
Partei. Andere Formen und Bedeutungen, wie etwa die<br />
juristische Vertrags- oder Prozesspartei, werden hier<br />
nicht verhandelt.<br />
21<br />
Vgl.: ALEMANN, Ulrich von: Das Parteiensystem der<br />
Bundesrepublik Deutschland, Bonn 2003, S. 9ff.<br />
22<br />
BEYME, Klaus von: Partei, Faktion, in: Otto Brunner/<br />
Werner Conze/ Reinhart Koselleck (Hrsg.), Geschichtliche<br />
Grundbegriffe: historisches Lexikon zur politisch-sozialen<br />
Sprache in Deutschland, Bd. 4, Stuttgart<br />
1978, S. 677–733 (732).<br />
23<br />
Gern zitiert wird Burke: “Party is a body of men<br />
united, for promoting by their joint endeavours the national<br />
interest, upon some particular principle in which<br />
they are all agreed.” Vgl.: BURKE, Edmund: thoughts on<br />
the cause of the present discontents (1770), in: Langford,<br />
Paul (Hrsg.), The writings and speeches of Edmund<br />
Burke, Bd. 2, Party, parliament and the American<br />
Crisis 1766–1774, Oxford 1981. S. 241–323 (317).<br />
24<br />
HAMILTON, Alexander/ MADISON, James/ JAY, John: Die<br />
Federalist-Artikel. Politische Theorie und Verfassungskommentar<br />
der amerikanischen Gründerväter, herausgegeben,<br />
übersetzt, eingeleitet und kommentiert von<br />
Angela Adams und Willi Paul Adams, Paderborn [u.a.]<br />
1994. S. 50–58.<br />
Zu Beginn des 19. Jahrhunderts sickert das Wort<br />
„Partei“ dann langsam und unter erheblichen<br />
Vorbehalten auch in den deutschen Sprachgebrauch<br />
ein. Nicht nur wird in der Zeit des Vormärz<br />
die praktische Entwicklung eines Parteienwesens<br />
durch die fehlenden konstitutionellen<br />
Andockmöglichkeiten behindert. Auch die herrschende<br />
Theorie in der Staatslehre wirkt einer<br />
Aufnahme organisierter Parteien in die Verfassungswirklichkeit<br />
entgegen. Hegel nennt als<br />
„vermittelndes Organ zwischen Regierung und<br />
Volk“ 26 die Stände, nicht die Parteien. Dennoch<br />
liefert Hegels Philosophie durch das Prinzip der<br />
Dialektik für seine Schüler einen Anknüpfungspunkt<br />
zur Begründung und Rechtfertigung des<br />
Parteibegriffs. Der Rechtshegelianer Karl Rosenkranz<br />
etwa definiert 1843 die Partei als „die<br />
selbstbewußte Einseitigkeit, welche das praktische<br />
Verhalten des Gemeinwesens bei seinen<br />
Gliedern in der Ungleichheit und dem aus ihr<br />
entstehenden Conflict der Bedürfnisse hervorruft“<br />
27 . In klarem Gegensatz zu seinem Meister<br />
wird außerdem die Ansicht vertreten, dass die<br />
Partei über den Stand hervorragt. Das dialektische<br />
Ringen der Parteien miteinander setze die<br />
Regierung in die komfortable Lage, „das wahrhafte<br />
Bedürfniß des Volkes zu erkennen“ 28 . Das<br />
Konzept einer Partei-Regierung verwirft jedoch<br />
auch Rosenkranz. Die Regierung, die den Staat<br />
in seiner Ganzheit und Einheit vertreten soll,<br />
habe „über den Parteien zu stehen“ 29 .<br />
Förmlich zu greifen ist hier ein für das liberale<br />
Denken im Vormärz typisches Verständnis von<br />
Partei im Sinne einer „Vertretung eines dem Ge-<br />
25<br />
Zur Abschaffung der Zünfte im März 1791 sowie zum<br />
Koalitions- und Streikverbot (Loi Le Chapelier) im<br />
Juni desselben Jahres vgl.: FURET, François/ RICHET,<br />
Denis: Die Französische Revolution, Frankfurt am<br />
Main 1997, S. 157f.<br />
26<br />
HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich: Die „Rechtsphilosophie“<br />
von 1820. Mit Hegels Vorlesungsnotizen 1821–<br />
1825, in: Karl-Heinz Ilting (Hrsg.), Georg Wilhelm<br />
Friedrich Hegel. Vorlesungen über Rechtsphilosophie<br />
1818–1831, Bd. 2, Stuttgart 1974. S. 770 (§ 302).<br />
27<br />
ROSENKRANZ, Karl: Über den Begriff der politischen<br />
Partei, in: Hermann Lübbe (Hrsg.), Die Hegelsche<br />
Rechte, Stuttgart 1962. S. 65–85 (65).<br />
28<br />
ROSENKRANZ, Über den Begriff..., S. 72.<br />
29<br />
ROSENKRANZ, Über den Begriff..., S. 82.<br />
8