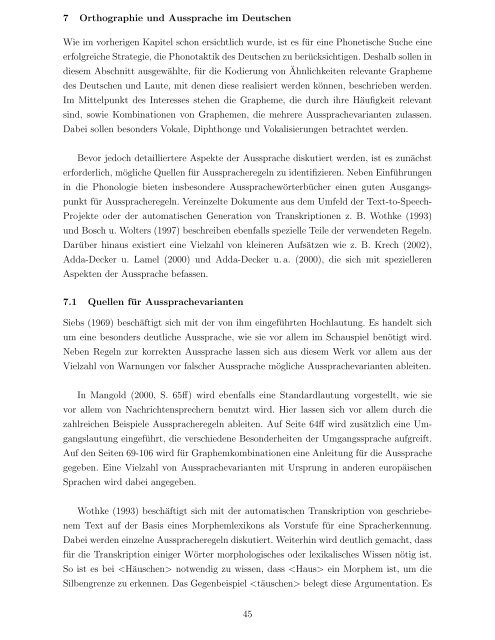pdf - Universität zu Köln
pdf - Universität zu Köln
pdf - Universität zu Köln
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
7 Orthographie und Aussprache im Deutschen<br />
Wie im vorherigen Kapitel schon ersichtlich wurde, ist es für eine Phonetische Suche eine<br />
erfolgreiche Strategie, die Phonotaktik des Deutschen <strong>zu</strong> berücksichtigen. Deshalb sollen in<br />
diesem Abschnitt ausgewählte, für die Kodierung von Ähnlichkeiten relevante Grapheme<br />
des Deutschen und Laute, mit denen diese realisiert werden können, beschrieben werden.<br />
Im Mittelpunkt des Interesses stehen die Grapheme, die durch ihre Häufigkeit relevant<br />
sind, sowie Kombinationen von Graphemen, die mehrere Aussprachevarianten <strong>zu</strong>lassen.<br />
Dabei sollen besonders Vokale, Diphthonge und Vokalisierungen betrachtet werden.<br />
Bevor jedoch detailliertere Aspekte der Aussprache diskutiert werden, ist es <strong>zu</strong>nächst<br />
erforderlich, mögliche Quellen für Ausspracheregeln <strong>zu</strong> identifizieren. Neben Einführungen<br />
in die Phonologie bieten insbesondere Aussprachewörterbücher einen guten Ausgangspunkt<br />
für Ausspracheregeln. Vereinzelte Dokumente aus dem Umfeld der Text-to-Speech-<br />
Projekte oder der automatischen Generation von Transkriptionen z. B. Wothke (1993)<br />
und Bosch u. Wolters (1997) beschreiben ebenfalls spezielle Teile der verwendeten Regeln.<br />
Darüber hinaus existiert eine Vielzahl von kleineren Aufsätzen wie z. B. Krech (2002),<br />
Adda-Decker u. Lamel (2000) und Adda-Decker u. a. (2000), die sich mit spezielleren<br />
Aspekten der Aussprache befassen.<br />
7.1 Quellen für Aussprachevarianten<br />
Siebs (1969) beschäftigt sich mit der von ihm eingeführten Hochlautung. Es handelt sich<br />
um eine besonders deutliche Aussprache, wie sie vor allem im Schauspiel benötigt wird.<br />
Neben Regeln <strong>zu</strong>r korrekten Aussprache lassen sich aus diesem Werk vor allem aus der<br />
Vielzahl von Warnungen vor falscher Aussprache mögliche Aussprachevarianten ableiten.<br />
In Mangold (2000, S. 65ff) wird ebenfalls eine Standardlautung vorgestellt, wie sie<br />
vor allem von Nachrichtensprechern benutzt wird. Hier lassen sich vor allem durch die<br />
zahlreichen Beispiele Ausspracheregeln ableiten. Auf Seite 64ff wird <strong>zu</strong>sätzlich eine Umgangslautung<br />
eingeführt, die verschiedene Besonderheiten der Umgangssprache aufgreift.<br />
Auf den Seiten 69-106 wird für Graphemkombinationen eine Anleitung für die Aussprache<br />
gegeben. Eine Vielzahl von Aussprachevarianten mit Ursprung in anderen europäischen<br />
Sprachen wird dabei angegeben.<br />
Wothke (1993) beschäftigt sich mit der automatischen Transkription von geschriebenem<br />
Text auf der Basis eines Morphemlexikons als Vorstufe für eine Spracherkennung.<br />
Dabei werden einzelne Ausspracheregeln diskutiert. Weiterhin wird deutlich gemacht, dass<br />
für die Transkription einiger Wörter morphologisches oder lexikalisches Wissen nötig ist.<br />
So ist es bei notwendig <strong>zu</strong> wissen, dass ein Morphem ist, um die<br />
Silbengrenze <strong>zu</strong> erkennen. Das Gegenbeispiel belegt diese Argumentation. Es<br />
45