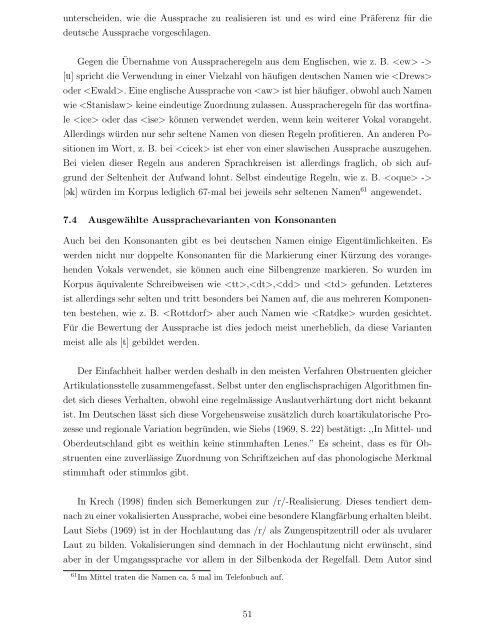pdf - Universität zu Köln
pdf - Universität zu Köln
pdf - Universität zu Köln
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
unterscheiden, wie die Aussprache <strong>zu</strong> realisieren ist und es wird eine Präferenz für die<br />
deutsche Aussprache vorgeschlagen.<br />
Gegen die Übernahme von Ausspracheregeln aus dem Englischen, wie z. B. -><br />
[u] spricht die Verwendung in einer Vielzahl von häufigen deutschen Namen wie <br />
oder . Eine englische Aussprache von ist hier häufiger, obwohl auch Namen<br />
wie keine eindeutige Zuordnung <strong>zu</strong>lassen. Ausspracheregeln für das wortfinale<br />
oder das können verwendet werden, wenn kein weiterer Vokal vorangeht.<br />
Allerdings würden nur sehr seltene Namen von diesen Regeln profitieren. An anderen Positionen<br />
im Wort, z. B. bei ist eher von einer slawischen Aussprache aus<strong>zu</strong>gehen.<br />
Bei vielen dieser Regeln aus anderen Sprachkreisen ist allerdings fraglich, ob sich aufgrund<br />
der Seltenheit der Aufwand lohnt. Selbst eindeutige Regeln, wie z. B. -><br />
[Ok] würden im Korpus lediglich 67-mal bei jeweils sehr seltenen Namen 61 angewendet.<br />
7.4 Ausgewählte Aussprachevarianten von Konsonanten<br />
Auch bei den Konsonanten gibt es bei deutschen Namen einige Eigentümlichkeiten. Es<br />
werden nicht nur doppelte Konsonanten für die Markierung einer Kür<strong>zu</strong>ng des vorangehenden<br />
Vokals verwendet, sie können auch eine Silbengrenze markieren. So wurden im<br />
Korpus äquivalente Schreibweisen wie ,, und gefunden. Letzteres<br />
ist allerdings sehr selten und tritt besonders bei Namen auf, die aus mehreren Komponenten<br />
bestehen, wie z. B. aber auch Namen wie wurden gesichtet.<br />
Für die Bewertung der Aussprache ist dies jedoch meist unerheblich, da diese Varianten<br />
meist alle als [t] gebildet werden.<br />
Der Einfachheit halber werden deshalb in den meisten Verfahren Obstruenten gleicher<br />
Artikulationsstelle <strong>zu</strong>sammengefasst. Selbst unter den englischsprachigen Algorithmen findet<br />
sich dieses Verhalten, obwohl eine regelmässige Auslautverhärtung dort nicht bekannt<br />
ist. Im Deutschen lässt sich diese Vorgehensweise <strong>zu</strong>sätzlich durch koartikulatorische Prozesse<br />
und regionale Variation begründen, wie Siebs (1969, S. 22) bestätigt: ,,In Mittel- und<br />
Oberdeutschland gibt es weithin keine stimmhaften Lenes.” Es scheint, dass es für Obstruenten<br />
eine <strong>zu</strong>verlässige Zuordnung von Schriftzeichen auf das phonologische Merkmal<br />
stimmhaft oder stimmlos gibt.<br />
In Krech (1998) finden sich Bemerkungen <strong>zu</strong>r /r/-Realisierung. Dieses tendiert demnach<br />
<strong>zu</strong> einer vokalisierten Aussprache, wobei eine besondere Klangfärbung erhalten bleibt.<br />
Laut Siebs (1969) ist in der Hochlautung das /r/ als Zungenspitzentrill oder als uvularer<br />
Laut <strong>zu</strong> bilden. Vokalisierungen sind demnach in der Hochlautung nicht erwünscht, sind<br />
aber in der Umgangssprache vor allem in der Silbenkoda der Regelfall. Dem Autor sind<br />
61 Im Mittel traten die Namen ca. 5 mal im Telefonbuch auf.<br />
51