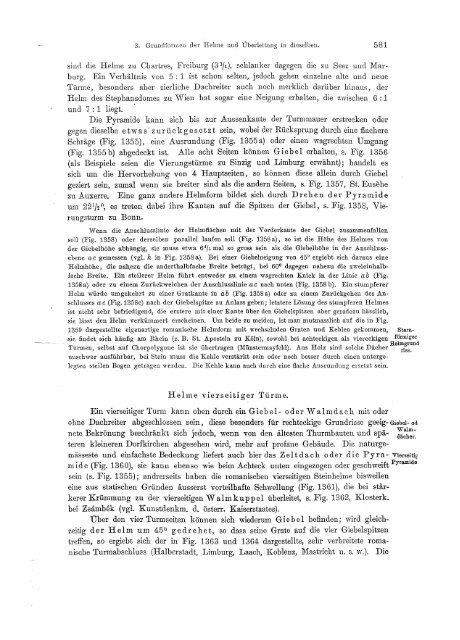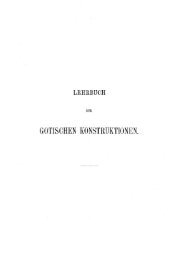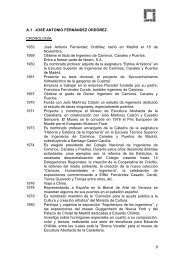- Seite 1 und 2:
LEHRBUCH DER GOTiSCHEN KONSTRUKTION
- Seite 3 und 4:
v. Die Kirche im Querschnitt und Au
- Seite 5 und 6:
1. Einschiffige Kirche Hila einsehi
- Seite 7 und 8:
1. Eimchi [ngc Kirche und cin,;chif
- Seite 9 und 10:
1. Ein~chirtige Kirche lind l'il\~(
- Seite 11 und 12:
I I T af el LXXIV. I~~~ .1 8~8~! Da
- Seite 13 und 14:
340 Y. r)ic~ Kil'i'hc' illl qllt'n:
- Seite 15 und 16:
342 V. Die Kirehe illl (.\ucrsl'hni
- Seite 17 und 18:
344 v. nie Kirche im Querschnitt l1
- Seite 19 und 20:
. Inneres Kaffgesims. 346 V. Die Ki
- Seite 21 und 22:
1. Eillschiffige Kirche und einschi
- Seite 23 und 24:
1. Einsc:hiffige Kirche und c:insc:
- Seite 25 und 26:
Tafel lXXVI. f" I ! Anlage 1 I ,I I
- Seite 27 und 28:
352 v. Di(' KirchI' il1l Q.ll('r;;l
- Seite 29 und 30:
1. Eil1~chirfib,' Kirche und ein~ch
- Seite 31 und 32:
Tafel TV\1! l H l1J.A \ .,. Inne re
- Seite 33 und 34:
356 V. nie Kirche illl Qllcrsdll1it
- Seite 35 und 36:
1. Ein,,,,hiffi,'-'" l\:il'e'he und
- Seite 37 und 38:
1. Einschiffigc Kirche und cinschif
- Seite 39 und 40:
1. EinsC'hifjl.~2:e Kirche und eins
- Seite 41 und 42:
1. Einschiffige Kirche ulld cinschi
- Seite 43 und 44:
, . , . . . . r====~~~~~~ l ~' ) \
- Seite 45 und 46:
366 V. Dic Kirchc im Qucrschnitt un
- Seite 47 und 48:
368 V. Die Kirche im Quersehnitt un
- Seite 49 und 50:
2. Hallrnkirehcn. 36D Schub des Mit
- Seite 51 und 52:
372 v, Die Kirche il11 QnersL:hnitt
- Seite 53 und 54:
2. Ha]J('nkirchen. 373 Der Schub, d
- Seite 55 und 56:
2. HaJlenkirchcn. 375 günstig: man
- Seite 57 und 58:
2. H:l.Jlenkirchen. 377 D. h. der D
- Seite 59 und 60:
,. Tafe11XXXlI, Das Dach der Hallen
- Seite 61 und 62:
380 V. Die Kirche im Querschnitt un
- Seite 63 und 64:
382 V. Die Kirehe im Quersdll1itt l
- Seite 65 und 66:
- ' ~~~~-~~~~~~~nc:urchen -mit Emp:
- Seite 67 und 68:
38G V. Die Kirche im Q.llerschnitt
- Seite 69 und 70:
3. Die Kirche mit erhöht.em J\ljtt
- Seite 71 und 72:
:3. Die Kirche mit erhöhkm Mittc]~
- Seite 73 und 74:
,tafel LXXXV, rr=== --~_. ~~~~=.~ ,
- Seite 75 und 76:
392 v. Die Kirche im Quer~chnitt un
- Seite 77 und 78:
394 V. Die Kirche im Querschnitt un
- Seite 79 und 80:
3. Dir' Kirche mit erhöhtcm iIlitL
- Seite 81 und 82:
:3. Dic Kirchc mit crhijlttcl1l Mit
- Seite 83 und 84:
:3. Die Kirche mit erhöhtem lIliLt
- Seite 85 und 86:
Der ~). Dil' Kirche lllit crhÖhtel
- Seite 87 und 88:
~~~~.""~ {909. 11 11 r=--- rTf (. ;
- Seite 89 und 90:
404 V. Die Kirche im Querschnitt un
- Seite 91 und 92:
4. Die EIlI\\"ickdnng der Triforien
- Seite 93 und 94:
I ! 'I I I l ' r. i T XXX 1V aJ:31l
- Seite 95 und 96:
408 V. Dic Kircllc im Querscbnitt u
- Seite 97 und 98:
4. Die Entwickelung tlcr Triforien.
- Seite 99 und 100:
5. Die gewölbtcn Emporbiih!len Üb
- Seite 101 und 102:
--, -~-- 'B CD "CJ (7) :.',ri ;"'-1
- Seite 103 und 104:
414 V. Die Kirche im Querschnitt un
- Seite 105 und 106:
(i. Der (luersdmiU der CilJrilChl'l
- Seite 107 und 108:
=-=i 'I 11,. il 11 TCl fp: . X '> 1
- Seite 109 und 110:
418 V. Die Kirche im Querschnitt un
- Seite 111 und 112:
6. Der Querschnitt der einf~ehen Cl
- Seite 113 und 114:
Tafel XCV -- -==-=== ==--==="- Gieo
- Seite 115 und 116:
422 V.Die Kirche im Querschnitt und
- Seite 117 und 118:
424 V. Die Kirche im Querschnitt un
- Seite 119 und 120:
7. Die äusscre Ausbildung der Gieb
- Seite 121 und 122:
VI. Die Gliederung und Bekrönung d
- Seite 123 und 124:
1. Die Gliedcrungcll im AJlgclllcin
- Seite 125 und 126:
T f 1 Xf" V1 {'] a e LV 01i ederung
- Seite 127 und 128:
432 VI. Die Gliederung' und Bekröl
- Seite 129 und 130:
434 YI. Die GliedertlI1g uud Bekrö
- Seite 131 und 132:
436 VI. Die GJiedcrung und Bekrönu
- Seite 133 und 134:
2. Dic Gesim
- Seite 135 und 136:
1 vr1fi T a fe 1 j~:~,~ \ I tI .~.
- Seite 137 und 138:
440 VI. Die Gliederung und Bekrönu
- Seite 139 und 140:
'. 442 VI. Die Gliederung und Bekr
- Seite 141 und 142:
2. Die Gesimsc. 443 Durch eine stei
- Seite 143 und 144:
2. Die Gesimse. 445 nach einem flac
- Seite 145 und 146:
3. Die arehiLektollisehe Ausbildung
- Seite 147 und 148:
3. Dip archil.ektonische AusbildulJ
- Seite 149 und 150:
er .f 1 "T -1381 Gi. r---- A:: ~ sb
- Seite 151 und 152:
452 VI. Die Gliederung und Bekrönu
- Seite 153 und 154:
454 VI. Die Gliederung und Bekrönu
- Seite 155 und 156:
456 VI. Die Gliederung und Bekrönu
- Seite 157 und 158:
3. Die architektonische Ausbildung
- Seite 159 und 160:
Tafel ClII. Fiale llnd Wimperge nac
- Seite 161 und 162:
4. Fialen. 461 leichterungen , kein
- Seite 163 und 164:
Tafel CIV. ~~~j ~ I 4- Ausbildun g
- Seite 165 und 166:
464 VI. Die Gliederung und Bekrönu
- Seite 167 und 168:
466 VI. Die Gliederung und Bekrönu
- Seite 169 und 170:
1. Fi"lcu- 467 den kleincrcn
- Seite 171 und 172:
4. Fialcn. 469 Brüstungsgesims der
- Seite 173 und 174:
5. Die Gicbcl \lnd IVil11pcrgcll. 4
- Seite 175 und 176:
Tafel CVI. -- -- Fensterwimperg e.
- Seite 177 und 178:
474 VI. Die Gliederung und Bekrönu
- Seite 179 und 180:
. Verschiedene Bildungen. 476 VI. D
- Seite 181 und 182:
.'5. Die Gicbel und "\vimpcrgcJ1. 4
- Seite 183 und 184:
, "', -;'~':::s::::~~:, , " , ' . ,
- Seite 185 und 186:
480 VI. Die Gliederung und Bekrönu
- Seite 187 und 188:
G. Von elen Bekrönungen und Laubbo
- Seite 189 und 190:
,,1 (", -I 'l ,] [ ) T (.; _L 1_) 1
- Seite 191 und 192:
484 VI. Die Gliederung und Bekrönu
- Seite 193 und 194:
';'. Y Oll elen Bah1achinen ulld Po
- Seite 195 und 196:
VII. Fenster und 1\tIass\verk. 1. D
- Seite 197 und 198:
1. Dic Fenstcr im allgemeincn. 489
- Seite 199 und 200:
"" 11 .i '1'_-1f'e-t i i cl - 1'; ~
- Seite 201 und 202:
492 VII. Fenster und :JIasswerk. :o
- Seite 203 und 204:
1. Die Fenster im alIgemeinen. 493
- Seite 205 und 206:
' 1. Die ,Fenstcr im allgemeinen, 4
- Seite 207 und 208:
Tabelle B. Geringste BeJastung der
- Seite 209 und 210:
1. Die Fenster im allgemeinen. 499
- Seite 211 und 212:
Tafel CXIV 114.9 Stärke unQ Belast
- Seite 213 und 214:
0 1 t 502 VII. Fenster und :\Iasswe
- Seite 215 und 216:
004 VII. Fenster und l\Iasswerk. De
- Seite 217 und 218:
:2. Das c\rkaden- und Fenstermasswe
- Seite 219 und 220:
-- Tafel CXVI. I I \ 1186~ ~ ~
- Seite 221 und 222:
508 YIr. Fenster und 1Iass,yerk. di
- Seite 223 und 224:
'2. Das Arkaden- und Fenstermass".c
- Seite 225 und 226:
- r------ I 1 1 ~ lLJ = ~
- Seite 227 und 228:
512 VII. Fenster- und 1I1ass\rerk.
- Seite 229 und 230:
'2. Das A rkaden- und Feusternwss\\
- Seite 231 und 232:
J. .\Iass\\-erk einfacher Pfosten-
- Seite 233 und 234:
.Tafel CXX. ~--~ ~-~--;--~ Zweiteil
- Seite 235 und 236:
518 VII. Fenster- und Masswerk. lic
- Seite 237 und 238:
3. ilIass,\'erk einfacher Pfosten-
- Seite 239 und 240:
Tafel CXXII Fruhgotiscne einfache R
- Seite 241 und 242:
522 VII. Fenster uud l.Iasswerk. gl
- Seite 243 und 244:
524 VII. Fenster und Masswerk. Grun
- Seite 245 und 246:
4. 1Iasswerk zusammengesetztC')" Pf
- Seite 248 und 249:
-1. )'!ass,yerk zusammcngesetzter P
- Seite 250 und 251:
, ('; :-.\lY'~/ [ :-I +;=;' Uv\\ ,-
- Seite 252 und 253:
530 VII. Feilster und Masswerk. erg
- Seite 254 und 255:
4. .:.Iasswerk zusammengesetzter Pf
- Seite 256 und 257:
1269
- Seite 258 und 259:
534 VII. Fenster und 1Ifasswerk. 'Y
- Seite 260 und 261:
536 VII. Fenster und Masswerk. das
- Seite 262 und 263: 6. Das Giebelmass,yerk. 58/ . l.1/;
- Seite 264 und 265: '1' 1 n .1 ai e CXXD~ « ~ - /---~~
- Seite 266 und 267: 540 VIII. Die ThÜren und Portale.
- Seite 268 und 269: 542 YIrI. Die Thürell und Portale.
- Seite 270 und 271: 1; ,~t fe- 1 C ~\~{)~ 1 ==-== ~- ~
- Seite 272 und 273: 544 VIII. Die Thiiren und Portale.
- Seite 274 und 275: 546 VIII. Die Thürcn und Portale.
- Seite 276 und 277: 548 VIII. Die ThÜren und Portale.
- Seite 278 und 279: 2. Das Bogenfeld oder Tympanon der
- Seite 280 und 281: 2. Das Bogenfeld oder Tympanon der
- Seite 282 und 283: 3. Die iiussere Umrnhmung nud Bekr
- Seite 284 und 285: Taf 81 CXAXIII r 1307. Tyrn})anon 1
- Seite 286 und 287: 556 VIII. Die Thi.iren und Portale.
- Seite 288 und 289: eieckige orhallen. 558 VIII. Die Th
- Seite 290 und 291: D60 VIII. Die Thüren und Portale.
- Seite 292 und 293: 1 I1 Reine ;iegelortaJe. !wände Bo
- Seite 294 und 295: 564 VIII. Die Thüren und Portale.
- Seite 296 und 297: 566 VIII. Die ThÜrcll und Portale.
- Seite 298 und 299: 7. Die ThiirflÜgel uud ihre Beschl
- Seite 300 und 301: IX. Die Aufrissent,vickelung der T
- Seite 302 und 303: 1. Die Ausbildung der TünÜe von d
- Seite 304 und 305: 2. Die Stockwerkteilung der TÜrme.
- Seite 306 und 307: Tafel CXYXV Aufnssoildung deI'Türm
- Seite 308 und 309: 576 IX. Die Aufrissentwickeluug der
- Seite 310 und 311: 578 IX. Die Aufrissentwickelung der
- Seite 314 und 315: 582 IX. Die Aufrissentwickelung der
- Seite 316 und 317: . kirchen 3. Grundformen der Helme
- Seite 318 und 319: T af el CXXXVlI AchteckIge Helme au
- Seite 320 und 321: '"~-_._.- 586 IX. Die Aufrissenbvic
- Seite 322 und 323: 3. Grundformen der Helme und Überl
- Seite 324 und 325: 3. Grundformen der Helme und Überl
- Seite 326 und 327: Tafel CXXX1X U eberle1Lllng m (LasA
- Seite 328 und 329: 1 , .592 IX. Die Aufrissentwickelun
- Seite 330 und 331: 4. Kleinere Türmchen. 593 ihren D
- Seite 332 und 333: 5. Steinerne Turmhelme. 595 , 5. St
- Seite 334 und 335: Tafel CXXXXI rl )' 1411 L-ieDfrauen
- Seite 336 und 337: 598 IX. Die A.ufrissentwickelung de
- Seite 338 und 339: 600 IX. Die Aufrissentwickelung der
- Seite 340 und 341: 602 IX. Die Aufrissentwickelung der
- Seite 342 und 343: 6. Beanspruchung, erforderliche'iVa
- Seite 344 und 345: 6. Beanspruchung, erforderliche ,Va
- Seite 346 und 347: 6. Beanspruchung, erforderliche vVa
- Seite 348 und 349: 6. Beanspruchung, erforderliche 'Ya
- Seite 350 und 351: 6. Beanspruchung] erforderliche "'I
- Seite 352 und 353: 6. Beanspruchung, erforderliche "\Y
- Seite 354 und 355: 7. Turmhelme aus Holz. 615 oder Met
- Seite 356 und 357: Tafel CXXXXIIl. ", r Holzhelme. 145
- Seite 358 und 359: 618 IX. Die Aufrissentwickelung der
- Seite 360 und 361: 620 XI. Die Auirissentwickelnng der
- Seite 362 und 363:
8. Beanspruchung der Holzhelme. 621
- Seite 364 und 365:
9. Beanspruchung der Turmwällde. 6
- Seite 366 und 367:
9. Beanspruchung der Turmwände. 62
- Seite 368 und 369:
9. Beanspi"uchung der Turmwände. B
- Seite 370 und 371:
x. Die dekorative Malerei. I. Die f
- Seite 372 und 373:
1. Die farbige Ausstattung des Inne
- Seite 374 und 375:
1. Die farbige Ausstattung des Inne
- Seite 376 und 377:
1. Die farbige Ausstattung des Inne
- Seite 378 und 379:
2. Die Technik der :Malerei im Mitt
- Seite 380 und 381:
2. Die Technik der :Malerei im Mitt
- Seite 382 und 383:
2. Die Tec]lllik der Malerei im Mit
- Seite 384 und 385:
. : T af CJ:J:XYN 11 1480. FarOige
- Seite 386 und 387:
644 X. Die dekorath--e Malerei. Rot
- Seite 388 und 389:
Zum Schluss sei noch darauf hingewi
- Seite 390 und 391:
Sch 1uss.~) . Die schärfste Auffas
- Seite 392 und 393:
A. Inhaltsverzeichnis. Anmerk. 1m v
- Seite 394 und 395:
650 A. Inhaltsverzeichnis. Seite I
- Seite 396 und 397:
652 A. Inhaltsverzeichnis. S6itA r
- Seite 398 und 399:
654 B. Ortsyerzeichnis der AbbPdung
- Seite 400 und 401:
656 B. Ortsverzeichnis der Abiii.!f
- Seite 402 und 403:
658 Mühlhausen. Namedy . Neustadt
- Seite 404 und 405:
660 .8. ,..'{tsverzeichnis der Abbi
- Seite 406 und 407:
662 C. Sachverzeichnis. Glasmalerei
- Seite 408:
Berichtigungen und Nachträge. S. 1