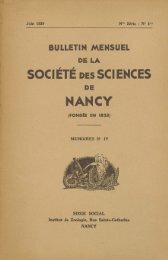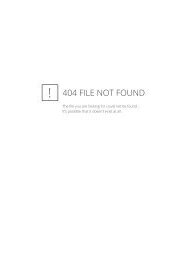CHRONIQUES ET COMPTES RENDUS
CHRONIQUES ET COMPTES RENDUS
CHRONIQUES ET COMPTES RENDUS
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
282 P<strong>ET</strong>ER STOTZ<br />
werden zunächst, über das sonst in Einleitungen Übliche weit hinausgehend, und unter<br />
Rückgriff auf ein breites und hier konkret reproduziertes Material, die historisch-politischen<br />
Konstellationen deutlich gemacht, in welchen diese drei Schriften Lupolds stehen.<br />
Schon früh gab es rabbinische Jesustraditionen, aus denen — vielleicht etwa zu Ende<br />
des 3. Jahrhunderts — ein zusammenhängender Text polemisch-parodierender Art<br />
geschaffen wurde. Unter dem Namen ‘Toldot Jeschu’ (‘[Abstammungs-]Geschichte<br />
Jesu’) war dieser im Mittelalter in zahlreichen Fassungen in Umlauf, außer in Hebräisch<br />
auch in Übersetzungen ins Arabische, Persische, Spanische und Deutsche. Die erste<br />
Spur einer Kenntnis davon im christlichen Westen findet sich in Form von Zitaten in der<br />
Schrift ‘De Iudaicis superstitionibus’ Agobards von Lyon von 826/827. Im 13. Jahrhundert<br />
gibt Raymundus Martinus in seinem ‘Pugio fidei adversus Mauros et Iudaeos’ eine<br />
größere Partie des ‘Toldot Jeschu’ in lateinischer Übersetzung wieder. Diese gelangte<br />
über die ‘Victoria Porcheti adversus impíos Hebreos’ des Porchetus de Salvaticis (1303,<br />
gedruckt 1520) zur Kenntnis Martin Luthers, der sie (1543) ins Deutsche übersetzte. Die<br />
erste vollständige Übersetzung des ‘Toldot Jeschu’ ins Lateinische stammt indessen von<br />
dem Wiener Geschichtsschreiber Thomas Ebendorfer (1388-1464) (vgl. zuletzt ALMA<br />
62, 2004, S. 245). Davon liegt eine autographe, mit Fehlem behaftete Abschrift Ebendorfers<br />
in einer Wiener Handschrift vor ; eine Kopie findet sich in einem Göttweiger<br />
Manuskript. Vor kurzem ist eine von einer deutschen Parallelübersetzung begleitete<br />
Ausgabe dieses und damit zusammenhängender Texte erschienen : Das jüdische Leben<br />
Jesu / Toldot Jeschu. Die älteste lateinische Übersetzung in den Falsitates Judeorum von<br />
Thomas Ebendorfer. Kritisch herausgegeben, eingeleitet, übersetzt und mit Anmerkungen<br />
versehen von Brigitta C a l l s e n , Fritz Peter K n a p p , Manuela N i e s n e r und Martin<br />
P r z y b i l s k i . (Veröffentlichungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung<br />
39). Wien / München : R. Oldenbourg, 2003. 107 Seiten. ISBN 3-7029-0475-1 (Wien) /<br />
3-486-46852-7 (München). Zu Ebendorfers Schrift ‘Falsitates Iudeorum’ gehören als<br />
rahmende Teile: 1] ein Prolog des Übersetzers, 2] nach dem Text von ‘Toldot Jeschu’<br />
ein in der Handschrift in hebräischer Sprache und Schrift wiedergegebenes, mit lateinischen<br />
Interlinearglossen versehenes (nur hier überliefertes) Schmähgedicht, begleitet<br />
von kurzgefaßten Anmerkungen Ebendorfers, sowie 3] ein gegen die Juden gerichteter<br />
Traktat Ebendorfers, der jedoch unvollendet geblieben oder hier nur unvollständig eingetragen<br />
worden ist. Beigegeben ist außerdem die lateinische Teilübersetzung des<br />
Porchetus samt deren deutscher Wiedergabe durch Luther. Seine Übersetzung des<br />
‘Toldot Jeschu’ hat Ebendorfer mit Hilfe eines jüdischen Konvertiten bewerkstelligt ;<br />
wahrscheinlich lief die Umsetzung über das Deutsche. Die Abfassung seiner antijüdischen<br />
Schrift als ganzer könnte, so vermuten die Herausgeber, von der Wiener Gesera<br />
von 1420, einem großangelegten Pogrom, angestoßen worden sein. Vielleicht gehört sie<br />
der Mitte des 15. Jahrhunderts an und bedeutet eine Stellungnahme gegen die verhältnismäßig<br />
judenfreundliche Politik Friedrichs III.<br />
Des Weiteren ist hier die Edition einer eigenen Schrift Ebendorfers anzuzeigen.<br />
Während der Arbeit an seiner Kaiserchronik (vgl. ALMA 62, 2004, S. 245) kam ihm der<br />
Gedanke, eine zurückblickende Abhandlung über die Schismen im Papsttum zu<br />
verfassen und dieser Chronik als Anhang beizugeben. Veranlassung dazu mögen ihm<br />
Eindrücke gegeben haben, die er 1432-1435 als Abgesandter der Universität Wien am<br />
Konzil von Basel empfing. Die Absicht ließ sich in dieser Form nicht verwirklichen, und<br />
so schuf er denn einen selbständigen Schismentraktat, begonnen bei dem Schisma<br />
zwischen Cornelius und Novatian und herabführend bis zu Kalixt III. und Pius II., der<br />
nur eben noch erwähnt wird. Der Hauptsache nach schrieb Ebendorfer diese Abhandlung<br />
1451 nieder, doch arbeitete er bis 1458 weiter daran. Ihr Text ist autograph überliefert<br />
in Handschrift 3423 der Österreichischen Nationalbibliothek in Wien, die zahl