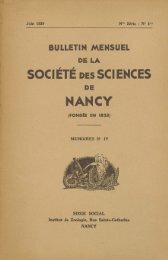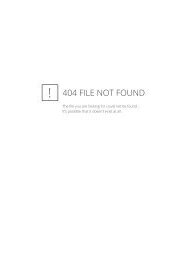CHRONIQUES ET COMPTES RENDUS
CHRONIQUES ET COMPTES RENDUS
CHRONIQUES ET COMPTES RENDUS
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>CHRONIQUES</strong> <strong>ET</strong> <strong>COMPTES</strong> <strong>RENDUS</strong> 289<br />
auf einen Komplex von Erzählungen zu sprechen, welche die Weihe einem übernatürlichen<br />
Eingreifen Christi und seiner Engel zuschreiben. In seiner Untersuchung geht er<br />
altkirchlichen Traditionen und Vorstellungen nach, welche diese Legenden vorbereitet<br />
und genährt haben dürften. Dann behandelt er die ältesten Weiheerzählungen selber,<br />
zunächst solche innerhalb hagiographischer Texte, dann solche in selbständiger Form.<br />
Hierauf fragt er nach dem jeweiligen kirchenpolitischen Umfeld dieser Legenden an<br />
einem bestimmten Ort. Als prominentes Fallbeispiel dient hier zunächst das Kloster<br />
Einsiedeln ; andere Orte folgen. Schließlich wird nach der zeitlichen Staffelung gefragt<br />
hinsichtlich einzelner Orte, Motive und Überlieferungsformen. Christus- und Engelweihlegenden<br />
insgesamt erscheinen erst nach 1000 ; sie lösen gewissermaßen die Erzählungen<br />
von Michaelserscheinungen im 879. Jh. ab. Die Anstöße zur Herausbildung<br />
solcher Erzählungen liegen weniger im Wettstreit zwischen älteren und jüngeren<br />
Klöstern oder in der Bedrückung durch Klostervögte als in dem Bestreben, gegenüber<br />
dem Diözesanbischof den « Status der spirituellen wie jurisdiktioneilen Unantastbarkeit<br />
» zu wahren. Im Mittelteil der Arbeit werden in alphabetischer Folge für zwanzig<br />
Orte, von Andechs über Figeac und Saint-Maur-des-Fosses bis Westminster, die<br />
einschlägigen Texte — fast durchweg sind es lateinische — gedruckt. Ihre Textform<br />
beruht auf älteren Ausgaben, die jedoch vielfach auf Grund der handschriftlichen Überlieferung<br />
revidiert worden sind. Im dritten Teil wird die bildliche Überlieferung behandelt<br />
für die Engelweihe der Bartholomäuspassion sowie für die Christus- und Engelweihe<br />
von St-Denis und von Einsiedeln.<br />
Wenigstens ganz knapp sei hingewiesen auf eine Arbeit geistesgeschichtlicher<br />
Ausrichtung, welche das Zeitverständnis in drei hochmittelalterlichen Weltchroniken<br />
zum Gegenstand hat : Fabian Schwarzbauer. Geschichtszeit. Über Zeitvorstellungen in<br />
den Universalchroniken Frutolfs von Michelsberg, Honorius’ Augustodunensis und<br />
Ottos von Freising. (Orbis mediaevalis, Vorstellungswelten des Mittelalters 6). Berlin :<br />
Akademie Verlag, 2005. 305 Seiten. ISBN 3-05-004112-9. — Der Arbeit, die auf eine<br />
historische Dissertation der Universität Hamburg von 2002 zurückgeht, ist zum Ziel<br />
gesetzt, «die allgemeinen Züge der Geschichtszeit in diesen Weltchroniken als<br />
Geschichtszeit des hochmittelalterlichen Weltchronisten auszuweisen und deren spezifische<br />
Ausformungen abzugrenzen ».<br />
An dieser Stelle ist eine begriffsgeschichtliche Untersuchung zu erwähnen : Peter<br />
v o n Moos. ‘Öffentlich’ und ‘privat’ im Mittelalter. Zu einem Problem historischer<br />
Begriffsbildung. (Schriften der Philosophisch-historischen Klasse der Heidelberger<br />
Akademie der Wissenschaften 33). Heidelberg : Winter, 2004. 107 Seiten. ISBN 3-8253-<br />
1668-8. — Die höchst vielschichtig geführte Erörterung kann hier nicht in wenigen<br />
Worten resümiert werden. Ausgangspunkt ist ein « forschungspraktisches Problem »,<br />
nämlich der Umstand, daß in der neueren deutschsprachigen Mediävistik berechtigte<br />
Hemmungen bestehen, die deutschen Begriffe ‘öffentlich’ und ‘privat’ auf mittelalterliche<br />
Verhältnisse anzuwenden. Der Verfasser der Studie geht dem Problem dadurch auf<br />
den Grund, daß er das zweipolige Begriffsfeld zeit- und sprachenübergreifend<br />
ausleuchtet. Dabei geht es zunächst um das Begriffspaar publicus / privatus und dessen<br />
Entsprechungen im Italienischen, Französischen und Englischen, mit Beizug auch von<br />
Srjpômoç und iôuüTr|ç. Herausgearbeitet wird so der Unterschied zwischen einem<br />
alteuropäischen Gemeinschaftsbegriff, der sich mit Ausdrücken wie res publica oder<br />
‘Gemeinnutz’ verbindet — dies in dem (politisch-sozialen) Spannungsfeld zwischen<br />
« universell » und « partikulär » —, einerseits, und einem im Deutschen geltenden<br />
Begriff von ‘öffentlich’ in dem (medialen) Sinne von ‘offen zutagetretend, manifest’ (im<br />
älteren Deutsch offenlich): einem Begriff, der als Substantiv ‘Öffentlichkeit’ mit der<br />
Aufklärung normative Züge angenommen hat. Im Zuge einer ausgreifenden Analyse