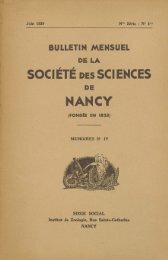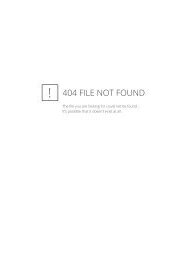CHRONIQUES ET COMPTES RENDUS
CHRONIQUES ET COMPTES RENDUS
CHRONIQUES ET COMPTES RENDUS
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>CHRONIQUES</strong> <strong>ET</strong> <strong>COMPTES</strong> <strong>RENDUS</strong> 287<br />
schichtlich von nicht minderem Interesse sind seine verschiedenen — kleineren und<br />
größeren — Dichtungen. Kürzlich ist hierzu ein willkommener kurzer Überblick vorgelegt<br />
worden : Stefan Weber. Ekkehardus poeta qui et doctus. Ekkehart IV. von St. Gallen<br />
und sein gelehrt poetisches Wirken. Nordhausen : Traugott Bautz, 2003. 103 Seiten.<br />
ISBN 3-88309-113-8. — Unter dem Obertitel Ekkehardus poeta wird zunächst ausführlich<br />
über die verschiedenartigen Dichtungen gehandelt, die Ekkehart autograph in seinen<br />
‘Liber benedictionum’ eingetragen hat: die vermischten Gedichte in ‘Benedictiones<br />
super lectores per circulum anni’, die Serie der spruchartigen ‘Benedictiones ad<br />
mensas’, die Gemäldetituli für Mainz und diejenigen für St. Gallen, seine Übersetzung<br />
von Ratperts althochdeutschem Galluslied und verschiedene Gelegenheitsgedichte sowie<br />
Epitaphien. Außerhalb dieser Sammlung steht eine Poetik in nuce, nämlich ‘De lege<br />
dictamen omandi’, stehen ferner Spottverse auf einen Trinker. Abgerundet wird dieser<br />
Teil mit Gedanken über Ekkeharts dichterischen Stil. Ein ganz kurzer zweiter Teil gilt<br />
dem Ekkehardus glossator, dies in engem Anschluß an einen Aufsatz von Peter Osterwalder<br />
mit diesem Obertitel (in : Variorum muñera florum..., Sigmaringen 1985, S. 73-<br />
82). Nützlich ist der anhangsweise beigegebene Überblick über alle Gedichte Ekkeharts<br />
IV. mit Incipit (bei den ganz kurzen Texten : mit Vollabdruck) und Nachweis der<br />
kritischen Edition.<br />
Von dem Bibelepos ‘Hypognosticon’ des Laurentius von Durham ist vor kurzem die<br />
kritische Erstedition vorgelegt worden (s. ALMA 62, 2004, S. 237). Nun hat die Herausgeberin<br />
dieses Textes den Ertrag ihrer interpretatorischen Arbeit daran in einer Monographie<br />
veröffentlicht : Susanne Daub. Von der Bibel zum Epos. Poetische Strategien des<br />
Laurentius am geistlichen Hof von Durham. Köln : Böhlau, 2005. 283 Seiten. ISBN<br />
3-412-14005-8. — Die Bearbeiterin bündelt ihre Beobachtungen nach den Kategorien<br />
‘Makrostrukturen’ und ‘Mikrostrukturen’. Unter dem ersten Gesichtspunkt geht es um<br />
die narrative Ordnung : einesteils um ihr Verhältnis zur Auswahl der Stoffe, andemteils<br />
um Vor- oder Rückgriffe. Wie es in der Natur der Sache liegt, gibt es an Mikrostrukturen<br />
weit mehr zu behandeln. Hauptgesichtspunkte sind hier der « narrative Schmuck » und<br />
die « gedankliche Intensivierung des Diskurses ». Unter den Begriff ‘Schmuck’ gestellt<br />
werden Ausführungen über Schlachtengemälde, Reden der auftretenden Figuren,<br />
Vergleiche mit Tieren, allegorische Bilder — hier : das Lebensschiff und das Gefängnis<br />
der Liebe —, sodann nicht-allegorische Beschreibungen, handle es sich um Dinge oder<br />
um Personen — hier: der Sara und des häßlichen Menschen —, und schließlich um<br />
katalogartige Textstellen. Als gedankliche Intensivierung werden hier gesehen : die<br />
Ausdeutung einzelner Erzählsequenzen — hier: Sündenfall, Josephsgeschichte und<br />
Amnons Liebe zu Thamar —, sodann die ausführliche Erörterung einzelner Gesichtspunkte.<br />
Hierunter fallen Exkurse wissenschaftlichen Charakters — etwa : zur Zeugungsfähigkeit<br />
alter Menschen — und solche meditativer Art — über das heilige Kreuz und<br />
Gottes Güte — und schließlich verschiedene Typen von Apostrophe : intradihegetisch —<br />
der Dichter spricht eine Figur der Erzählung an —, extradihegetisch — er spricht den<br />
Leser an — oder aber als Anrede seiner selbst oder seiner Muse. Die gewonnenen<br />
Einsichten in die handwerklichen Fertigkeiten und die literarischen Verfahren des<br />
Dichters werden in Form von Zwischenergebnissen und in einer Gesamtwertung zusammengefaßt.<br />
Wer sich bisher mit der Überlieferungsgeschichte der Werke der Hildegard von<br />
Bingen (1098-1179) befaßte, tat dies vorwiegend unter textkritischen Gesichtspunkten<br />
und fragte nach Überlieferungen, welche der Autorin besonders nahestehen. Von anderen<br />
Hauptgesichtspunkten geleitet ist die folgende Arbeit : Michael Embach. Die Schriften<br />
Hildegards von Bingen. Studien zu ihrer Überlieferung und Rezeption im Mittelalter und<br />
der Frühen Neuzeit. (Erudiri sapientia. Studien zum Mittelalter und zu seiner Rezepti