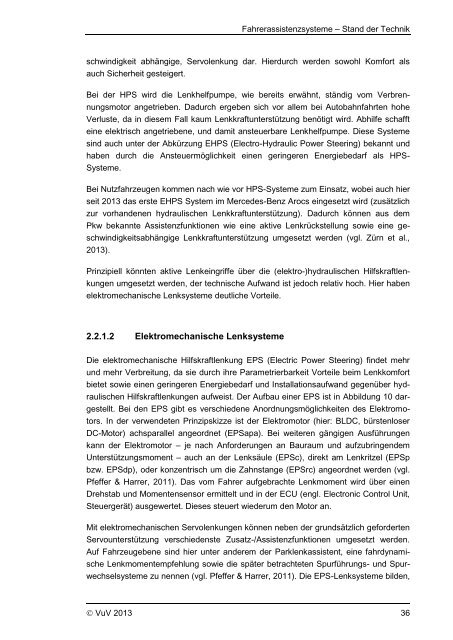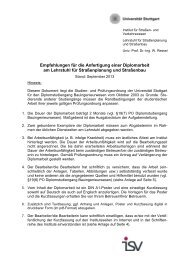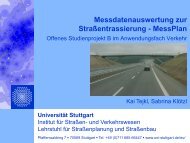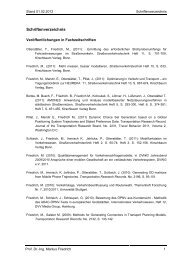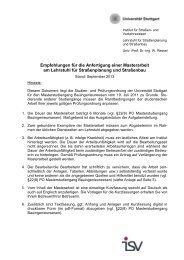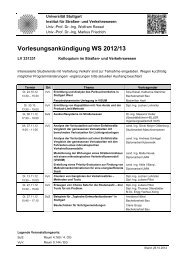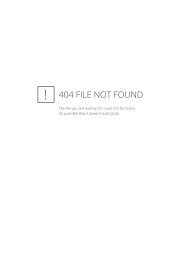Link Ausarbeitung - Institut für Straßen- und Verkehrswesen
Link Ausarbeitung - Institut für Straßen- und Verkehrswesen
Link Ausarbeitung - Institut für Straßen- und Verkehrswesen
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Fahrerassistenzsysteme – Stand der Technik<br />
schwindigkeit abhängige, Servolenkung dar. Hierdurch werden sowohl Komfort als<br />
auch Sicherheit gesteigert.<br />
Bei der HPS wird die Lenkhelfpumpe, wie bereits erwähnt, ständig vom Verbrennungsmotor<br />
angetrieben. Dadurch ergeben sich vor allem bei Autobahnfahrten hohe<br />
Verluste, da in diesem Fall kaum Lenkkraftunterstützung benötigt wird. Abhilfe schafft<br />
eine elektrisch angetriebene, <strong>und</strong> damit ansteuerbare Lenkhelfpumpe. Diese Systeme<br />
sind auch unter der Abkürzung EHPS (Electro-Hydraulic Power Steering) bekannt <strong>und</strong><br />
haben durch die Ansteuermöglichkeit einen geringeren Energiebedarf als HPS-<br />
Systeme.<br />
Bei Nutzfahrzeugen kommen nach wie vor HPS-Systeme zum Einsatz, wobei auch hier<br />
seit 2013 das erste EHPS System im Mercedes-Benz Arocs eingesetzt wird (zusätzlich<br />
zur vorhandenen hydraulischen Lenkkraftunterstützung). Dadurch können aus dem<br />
Pkw bekannte Assistenzfunktionen wie eine aktive Lenkrückstellung sowie eine geschwindigkeitsabhängige<br />
Lenkkraftunterstützung umgesetzt werden (vgl. Zürn et al.,<br />
2013).<br />
Prinzipiell könnten aktive Lenkeingriffe über die (elektro-)hydraulischen Hilfskraftlenkungen<br />
umgesetzt werden, der technische Aufwand ist jedoch relativ hoch. Hier haben<br />
elektromechanische Lenksysteme deutliche Vorteile.<br />
2.2.1.2 Elektromechanische Lenksysteme<br />
Die elektromechanische Hilfskraftlenkung EPS (Electric Power Steering) findet mehr<br />
<strong>und</strong> mehr Verbreitung, da sie durch ihre Parametrierbarkeit Vorteile beim Lenkkomfort<br />
bietet sowie einen geringeren Energiebedarf <strong>und</strong> Installationsaufwand gegenüber hydraulischen<br />
Hilfskraftlenkungen aufweist. Der Aufbau einer EPS ist in Abbildung 10 dargestellt.<br />
Bei den EPS gibt es verschiedene Anordnungsmöglichkeiten des Elektromotors.<br />
In der verwendeten Prinzipskizze ist der Elektromotor (hier: BLDC, bürstenloser<br />
DC-Motor) achsparallel angeordnet (EPSapa). Bei weiteren gängigen Ausführungen<br />
kann der Elektromotor – je nach Anforderungen an Bauraum <strong>und</strong> aufzubringendem<br />
Unterstützungsmoment – auch an der Lenksäule (EPSc), direkt am Lenkritzel (EPSp<br />
bzw. EPSdp), oder konzentrisch um die Zahnstange (EPSrc) angeordnet werden (vgl.<br />
Pfeffer & Harrer, 2011). Das vom Fahrer aufgebrachte Lenkmoment wird über einen<br />
Drehstab <strong>und</strong> Momentensensor ermittelt <strong>und</strong> in der ECU (engl. Electronic Control Unit,<br />
Steuergerät) ausgewertet. Dieses steuert wiederum den Motor an.<br />
Mit elektromechanischen Servolenkungen können neben der gr<strong>und</strong>sätzlich geforderten<br />
Servounterstützung verschiedenste Zusatz-/Assistenzfunktionen umgesetzt werden.<br />
Auf Fahrzeugebene sind hier unter anderem der Parklenkassistent, eine fahrdynamische<br />
Lenkmomentempfehlung sowie die später betrachteten Spurführungs- <strong>und</strong> Spurwechselsysteme<br />
zu nennen (vgl. Pfeffer & Harrer, 2011). Die EPS-Lenksysteme bilden,<br />
VuV 2013 36