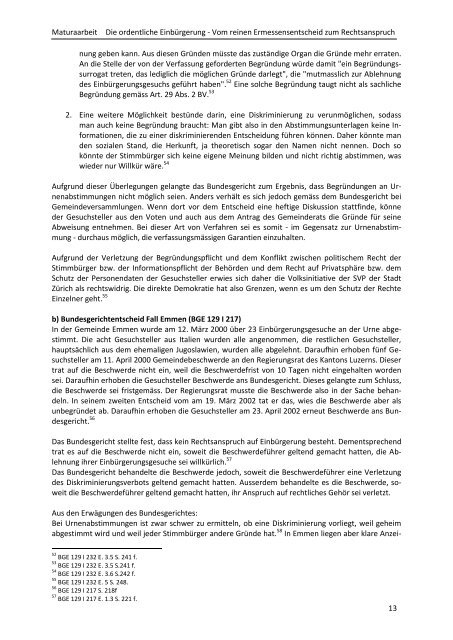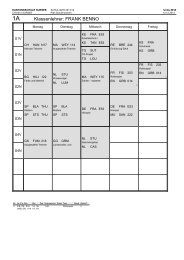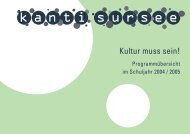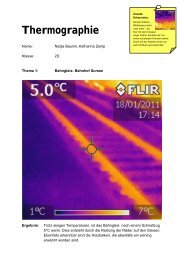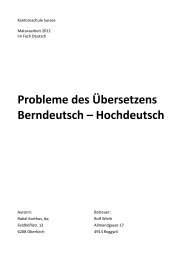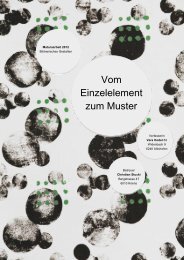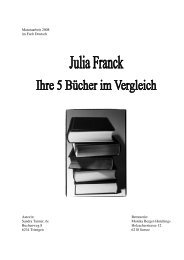Die ordentliche Einbürgerung - Sursee
Die ordentliche Einbürgerung - Sursee
Die ordentliche Einbürgerung - Sursee
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Maturaarbeit<br />
<strong>Die</strong> <strong>ordentliche</strong> Einbürgerung - Vom reinen Ermessensentscheid zum Rechtsanspruch<br />
nung geben kann. Aus diesen Gründen müsste das zuständige Organ die Gründe mehr erraten.<br />
An die Stelle der von der Verfassung geforderten Begründung würde damit "ein Begründungssurrogat<br />
treten, das lediglich die möglichen Gründe darlegt", die "mutmasslich zur Ablehnung<br />
des Einbürgerungsgesuchs geführt haben". 52 Eine solche Begründung taugt nicht als sachliche<br />
Begründung gemäss Art. 29 Abs. 2 BV. 53<br />
2. Eine weitere Möglichkeit bestünde darin, eine Diskriminierung zu verunmöglichen, sodass<br />
man auch keine Begründung braucht: Man gibt also in den Abstimmungsunterlagen keine Informationen,<br />
die zu einer diskriminierenden Entscheidung führen können. Daher könnte man<br />
den sozialen Stand, die Herkunft, ja theoretisch sogar den Namen nicht nennen. Doch so<br />
könnte der Stimmbürger sich keine eigene Meinung bilden und nicht richtig abstimmen, was<br />
wieder nur Willkür wäre. 54<br />
Aufgrund dieser Überlegungen gelangte das Bundesgericht zum Ergebnis, dass Begründungen an Urnenabstimmungen<br />
nicht möglich seien. Anders verhält es sich jedoch gemäss dem Bundesgericht bei<br />
Gemeindeversammlungen. Wenn dort vor dem Entscheid eine heftige Diskussion stattfinde, könne<br />
der Gesuchsteller aus den Voten und auch aus dem Antrag des Gemeinderats die Gründe für seine<br />
Abweisung entnehmen. Bei dieser Art von Verfahren sei es somit - im Gegensatz zur Urnenabstimmung<br />
- durchaus möglich, die verfassungsmässigen Garantien einzuhalten.<br />
Aufgrund der Verletzung der Begründungspflicht und dem Konflikt zwischen politischem Recht der<br />
Stimmbürger bzw. der Informationspflicht der Behörden und dem Recht auf Privatsphäre bzw. dem<br />
Schutz der Personendaten der Gesuchsteller erwies sich daher die Volksinitiative der SVP der Stadt<br />
Zürich als rechtswidrig. <strong>Die</strong> direkte Demokratie hat also Grenzen, wenn es um den Schutz der Rechte<br />
Einzelner geht. 55<br />
b) Bundesgerichtentscheid Fall Emmen (BGE 129 I 217)<br />
In der Gemeinde Emmen wurde am 12. März 2000 über 23 Einbürgerungsgesuche an der Urne abgestimmt.<br />
<strong>Die</strong> acht Gesuchsteller aus Italien wurden alle angenommen, die restlichen Gesuchsteller,<br />
hauptsächlich aus dem ehemaligen Jugoslawien, wurden alle abgelehnt. Daraufhin erhoben fünf Gesuchsteller<br />
am 11. April 2000 Gemeindebeschwerde an den Regierungsrat des Kantons Luzerns. <strong>Die</strong>ser<br />
trat auf die Beschwerde nicht ein, weil die Beschwerdefrist von 10 Tagen nicht eingehalten worden<br />
sei. Daraufhin erhoben die Gesuchsteller Beschwerde ans Bundesgericht. <strong>Die</strong>ses gelangte zum Schluss,<br />
die Beschwerde sei fristgemäss. Der Regierungsrat musste die Beschwerde also in der Sache behandeln.<br />
In seinem zweiten Entscheid vom am 19. März 2002 tat er das, wies die Beschwerde aber als<br />
unbegründet ab. Daraufhin erhoben die Gesuchsteller am 23. April 2002 erneut Beschwerde ans Bundesgericht.<br />
56<br />
Das Bundesgericht stellte fest, dass kein Rechtsanspruch auf Einbürgerung besteht. Dementsprechend<br />
trat es auf die Beschwerde nicht ein, soweit die Beschwerdeführer geltend gemacht hatten, die Ablehnung<br />
ihrer Einbürgerungsgesuche sei willkürlich. 57<br />
Das Bundesgericht behandelte die Beschwerde jedoch, soweit die Beschwerdeführer eine Verletzung<br />
des Diskriminierungsverbots geltend gemacht hatten. Ausserdem behandelte es die Beschwerde, soweit<br />
die Beschwerdeführer geltend gemacht hatten, ihr Anspruch auf rechtliches Gehör sei verletzt.<br />
Aus den Erwägungen des Bundesgerichtes:<br />
Bei Urnenabstimmungen ist zwar schwer zu ermitteln, ob eine Diskriminierung vorliegt, weil geheim<br />
abgestimmt wird und weil jeder Stimmbürger andere Gründe hat. 58 In Emmen liegen aber klare Anzei-<br />
52 BGE 129 I 232 E. 3.5 S. 241 f.<br />
53 BGE 129 I 232 E. 3.5 S.241 f.<br />
54 BGE 129 I 232 E. 3.6 S.242 f.<br />
55 BGE 129 I 232 E. 5 S. 248.<br />
56 BGE 129 I 217 S. 218f<br />
57 BGE 129 I 217 E. 1.3 S. 221 f.<br />
13