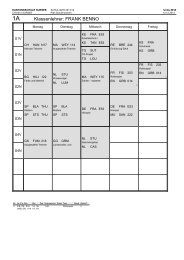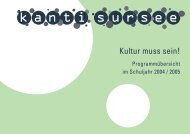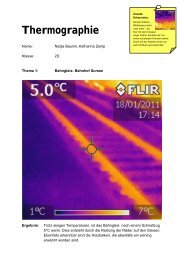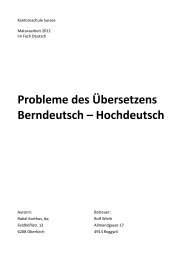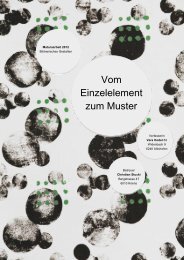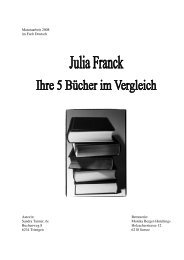Die ordentliche Einbürgerung - Sursee
Die ordentliche Einbürgerung - Sursee
Die ordentliche Einbürgerung - Sursee
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Maturaarbeit<br />
<strong>Die</strong> <strong>ordentliche</strong> Einbürgerung - Vom reinen Ermessensentscheid zum Rechtsanspruch<br />
2 Einleitung<br />
<strong>Die</strong> Fragen, die sich rund um das Thema Einbürgerung stellen, haben mich schon immer interessiert,<br />
zumal sich mein Vater vor einiger Zeit eingebürgert hat. Auch habe ich die Auseinandersetzung in den<br />
Medien verfolgt. <strong>Die</strong> Maturaarbeit ist ein geeigneter Anlass, sich mit dem Thema genauer zu befassen.<br />
Wie der Titel der Arbeit sagt, behandelt meine Arbeit die Frage, ob die <strong>ordentliche</strong> Einbürgerung im<br />
Zeitraum vom 2003 bis heute eine Veränderung vom reinen Ermessensentscheid hin zu einem Rechtsanspruch<br />
erfahren hat. Es ist zu fragen, wie sich das Verfahren und der Rechtscharakter der <strong>ordentliche</strong>n<br />
Einbürgerung verändert haben. Hauptsächlich wird untersucht, ob man aus diesen Veränderungen<br />
auf eine Verrechtlichung schliessen kann und ob dadurch ein Rechtsanspruch auf Einbürgerung<br />
entsteht. Wie es zur Frage nach einer Verrechtlichung kommen konnte, wird im Folgenden kurz aufgezeigt.<br />
<strong>Die</strong> Erteilung des Gemeindebürgerrechts an einen Ausländer, die immer Voraussetzung für die Erteilung<br />
des Kantons- und auch des Schweizerbürgerrechts ist 1 , wird seit langem als eine der wichtigsten<br />
Zuständigkeiten der Gemeindeversammlung betrachtet. <strong>Die</strong> Vorstellung, dass sich in der Gemeindeversammlung<br />
die Gesamtheit der Stimmbürger versammelt, um dort über die Anträge von Ausländern<br />
um Aufnahme ins Gemeindebürgerrecht ausführlich für jeden einzelnen Kandidaten zu diskutieren<br />
und dann abzustimmen, ist in der Vorstellung vieler Schweizer ein wichtiges Element der direkten<br />
Demokratie. <strong>Die</strong>se "urdemokratische" Vorstellung über den Prozess der Aufnahme von Ausländern ins<br />
Bürgerrecht spiegelte sich denn auch lange Zeit in der juristischen Literatur. Es bestand Einigkeit darüber,<br />
dass die "Einbürgerung unter allen Umständen einen politischen Akt darstellt, welcher aufgrund<br />
der Staatssouveränität vollzogen wird. Gemeinden und Kantone sollen absolut frei sein, einen Gesuchsteller<br />
ins Bürgerrecht aufzunehmen oder nicht". 2 <strong>Die</strong>se "Doktrin des politischen Aktes" hatte<br />
praktische Auswirkungen vor allem darin, dass nach einhelliger Meinung kein Anspruch auf (<strong>ordentliche</strong>)<br />
Einbürgerung bestand 3 und dass die Erteilung des Bürgerrechts im freien Ermessen der zuständigen<br />
Behörde stand. 4 Der Weiterzug ablehnender Bürgerrechtsentscheide an ein Gericht war dementsprechend<br />
aussichtslos. Abgesehen davon, dass in vielen Kantone gar keine Weiterzugsmöglichkeit an<br />
ein Gericht bestand, war auch ein Gang ans Bundesgericht regelmässig zum Scheitern verurteilt, weil<br />
das Bundesgericht auf entsprechende Beschwerden gar nicht eintrat, d.h. es ablehnte, diese überhaupt<br />
zu behandeln. 5 <strong>Die</strong>s hat sich mit zwei Urteilen, die das Bundesgericht am 9. Juli 2003 gefällt hat,<br />
entscheidend geändert. In den beiden genannten Urteilen ist das Bundesgericht erstmals auf Beschwerden<br />
abgelehnter Bürgerrechtsbewerber (teilweise) eingetreten und hat diese sogar gutgeheissen.<br />
<strong>Die</strong> beiden Urteile wurden sowohl in der Bevölkerung als auch in Juristenkreisen als eigentlicher<br />
"Paukenschlag" empfunden und haben sehr unterschiedliche Aufnahme gefunden: Während die Urteile<br />
zum Teil geradezu enthusiastisch begrüsst wurden, sahen viele Vertreter traditioneller Kreise darin<br />
eine Bedrohung "urschweizerischer" Grundwerte.<br />
Ausgehend von einer Erläuterung der Rechtsgrundlagen werden im Hauptteil der Maturaarbeit die<br />
beiden erwähnten Urteile des Bundesgerichts vom 9. Juli 2003 und die darauffolgenden Reaktionen,<br />
sowohl in der Rechtsprechung des Bundesgerichts wie auch in der Gesetzgebung, erläutert und die<br />
Tendenz zu Verrechtlichung der Einbürgerung aufgezeigt.<br />
Anschliessend wird am Beispiel des Kantons Luzern dargelegt, welche Auswirkungen die Änderungen<br />
auf Bundesebene für die Gemeinden hatten. Untersucht werden hauptsächlich Faktoren, bei denen es<br />
Veränderungen gegeben hat, die den Spielraum bezüglich der Verfahrensart und der Überprüfung des<br />
Gesuchs auf Eignung des Gesuchstellers betreffen.<br />
Der Einfachheit halber wird in der Arbeit nur jeweils die männliche Form genannt, es sind jedoch immer<br />
beide Geschlechter gemeint.<br />
1 Vgl. zu dieser sogenannten Dreistufigkeit des Schweizer Bürgerrechts Kapitel 3.1<br />
2 Werner Baumann, S. 558.<br />
3 vgl. statt vieler Fleiner/Giacometti, S. 190; Etienne Grisel, in: Kommentar aBV, N 57 zu Art. 44 aBV.<br />
4 vgl. wiederum Fleiner/Giacometti, S. 190; Etienne Grisel, in: Kommentar aBV, N 57 zu Art. 44 aBV.<br />
5 vgl. zur Begründung dieser Rechtsprechung Kapitel 4.1.1 und 4.1.2<br />
5