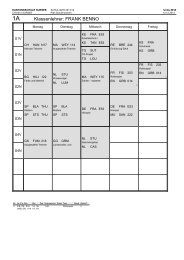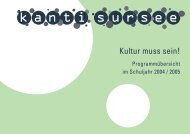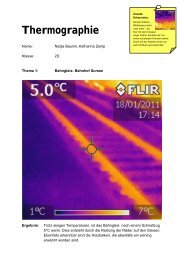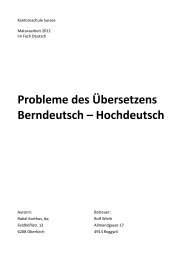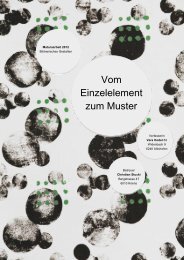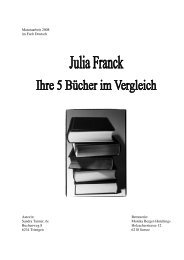Die ordentliche Einbürgerung - Sursee
Die ordentliche Einbürgerung - Sursee
Die ordentliche Einbürgerung - Sursee
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Maturaarbeit<br />
<strong>Die</strong> <strong>ordentliche</strong> Einbürgerung - Vom reinen Ermessensentscheid zum Rechtsanspruch<br />
c) Schutz der Privatsphäre (Art. 15 c Abs. 1 - 3 BüG)<br />
In dieser neuen Bestimmung wird festgehalten, dass die Privatsphäre der Gesuchsteller nicht verletzt<br />
werden darf. Daher dürfen nicht alle Daten über den Gesuchsteller bzw. die Gesuchstellerin den<br />
Stimmbürgern unterbereitet werden. <strong>Die</strong>ser Artikel unterstützt damit in gewisser Hinsicht die Meinung<br />
des Bundesgerichtes, dass die Einbürgerung ein Verwaltungsakt ist und somit der Schutz der<br />
Privatsphäre der Gesuchsteller gegenüber den politischen Rechten der Stimmbürger Vorrang hat.<br />
In Absatz 2 der Bestimmung wird definiert, welche Angaben die Stimmberechtigten erhalten dürfen.<br />
Neben der Staatsangehörigkeit und der Wohnsitzdauer dürfen auch „Angaben, die erforderlich sind<br />
zur Beurteilung der Einbürgerungsvoraussetzungen, insbesondere der Integration in die schweizerischen<br />
Verhältnisse“ 95 veröffentlicht werden. Somit steht es dem Kanton und den Gemeinden immer<br />
noch frei, welche Angaben sie machen wollen. Jedoch dürfen sie wirklich nur Angaben machen, die für<br />
eine Entscheidungsfindung der Stimmbürger relevant sind. Angaben zur Höhe des Vermögens oder<br />
des Einkommens gehören damit der Vergangenheit an.<br />
In den Erläuterungen zu den einzelnen Bestimmungen wird im Bericht der staatspolitischen Kommission<br />
des Ständerats vom 27. Oktober 2005 präzisiert, welche Daten veröffentlich werden können. <strong>Die</strong><br />
Veröffentlichung hängt auch vom Adressatenkreis ab. Das heisst für die Gemeinden konkret, je grösser<br />
der Adressatenkreis ist, desto weniger persönliche Daten dürfen die Behörden den Stimmbürgern<br />
unterbreiten, damit der Schutz der Privatsphäre gewährleistet bleibt.<br />
Dadurch dass der Schutz der Privatsphäre bei Einbürgerungen neu im Bürgerrechtsgesetz verankert<br />
ist, zeigt der Gesetzgeber, dass die Einbürgerung als ein Rechtsanwendungsakt zu verstehen ist und<br />
somit der Schutz der Privatsphäre der Gesuchsteller den politischen Rechten der Stimmbürger vorgeht.<br />
96<br />
d) Beschwerde vor einem kantonalen Gericht (Art. 50 BüG)<br />
<strong>Die</strong>se Bestimmung verpflichtet die Kantone, eine Gerichtsbehörde einzusetzen, die sich mit ablehnenden<br />
Einbürgerungsentscheiden von Gemeinden oder Kantonen befasst. Dadurch entsteht für jeden<br />
Gesuchsteller die Möglichkeit, Beschwerde im Kanton einzureichen. 97<br />
<strong>Die</strong>s zeigt wiederum, dass der Gesetzgeber, gleich wie das Bundesgericht, die Einbürgerung überwiegend<br />
als einen Verwaltungs- und Rechtsanwendungsakt sieht. Daher gelten insbesondere auch die<br />
Verfahrensgarantien von Art. 29 BV (rechtliches Gehör, Akteneinsichtsrecht, Anspruch auf Begründung).<br />
Auch hier ist klar die Verrechtlichung der Einbürgerung zu erkennen. Denn zuvor konnte der abgelehnte<br />
Gesuchsteller nur Beschwerde am Bundesgericht einreichen. <strong>Die</strong>ses ist jedoch in der Überprüfung<br />
des Falles eingeschränkt. Insbesondere prüfen die kantonalen Gerichte - anders als das Bundesgericht<br />
98 - auch dann, wenn kein Rechtsanspruch auf Erteilung des Bürgerrechts besteht, ob das Willkürverbot<br />
verletzt wurde. Abgelehnte Bürgerrechtsbewerber können somit vor dem kantonalen Gericht<br />
gemäss Art. 50 BüG geltend machen, die Ablehnung sei willkürlich, d.h. grob ungerecht. Im Ergebnis<br />
entsteht damit für die Gesuchsteller eben doch ein "schwacher" Anspruch auf Einbürgerung: Wenn es<br />
keine guten (d.h. nicht-willkürlichen) Gründe gegen die Einbürgerung gibt, muss eingebürgert werden.<br />
4.6 <strong>Die</strong> Volksabstimmung vom 1. Juni 2008 über die Initiative „für demokratische Einbürgerungen“<br />
der SVP<br />
4.6.1 <strong>Die</strong> Ausgangslage<br />
Am 6. April 2004 lancierte die SVP die Volksinitiative „für demokratische Einbürgerungen“. <strong>Die</strong> Sammelfrist<br />
für die Unterschriften lief bis am 18. November 2005 und es wurde bis dann auch die nötige<br />
Anzahl Unterschriften eingereicht. Am 25. Oktober 2006 lehnte der Bundesrat die Volksinitiative ab. 99<br />
<strong>Die</strong> Bundesversammlung prüfte den Inhalt der Initiative, ob dieser nicht die Menschenrechte und<br />
95 Art 15c Abs. 2BüG.<br />
96 BBl 2005 6953.<br />
97 BBl 2005 6953.<br />
98 Siehe dazu oben Abschnitt 4.1.1 c) zur einschränkenden Praxis des Bundesgerichts zum Willkürverbot.<br />
99 BBl 2006 8954.<br />
21