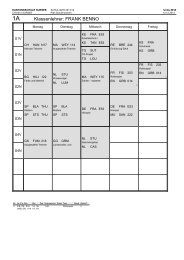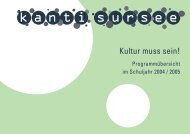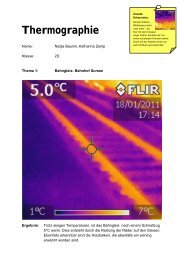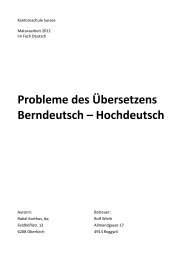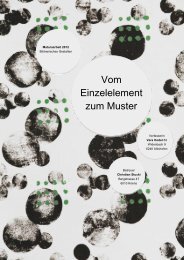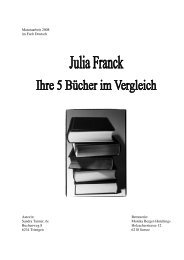Die ordentliche Einbürgerung - Sursee
Die ordentliche Einbürgerung - Sursee
Die ordentliche Einbürgerung - Sursee
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Maturaarbeit<br />
<strong>Die</strong> <strong>ordentliche</strong> Einbürgerung - Vom reinen Ermessensentscheid zum Rechtsanspruch<br />
6 Fazit<br />
Insgesamt lässt sich feststellen, dass es in den letzten Jahren zu einer starken Verrechtlichung bei der<br />
<strong>ordentliche</strong>n Einbürgerung gekommen ist. Hauptsächlich dazu beigetragen haben die beiden Entscheide<br />
des Bundesgerichts im Jahr 2003. <strong>Die</strong> Entscheide stellten klar, dass die Einbürgerung nicht nur<br />
ein politischer Akt ist, sondern auch oder vor allem ein Rechtsanwendungs- bzw. Verwaltungsakt. Das<br />
Bundesgericht erklärte die Urnenabstimmungen als rechtswidrig, weil für ein abgelehntes Gesuch eine<br />
Begründung benötigt wird und die Privatsphäre des Gesuchstellers gewährleistet sein muss, was bei<br />
der Urnenabstimmung nicht der Fall ist. <strong>Die</strong> Begründungspflicht stellt klar eine Verrechtlichung dar, da<br />
der Gesuchsteller nun weiss, weshalb er abgelehnt wurde und dadurch auch die Möglichkeit erhält,<br />
sich sachgenmäss gegen einen Entscheid zu wehren. Diskriminierende und willkürliche Entscheide sind<br />
daher nicht mehr möglich, da sie nicht sachlich begründet werden können. <strong>Die</strong> Initiative Pfisterer im<br />
Jahr 2007 verankerte die Rechtsprechung des Bundesgerichts im BüG und präzisierte im Bereich des<br />
Schutzes der Privatsphäre, welche Daten über den Gesuchsteller veröffentlicht werden dürfen. <strong>Die</strong><br />
Initiative führte auch zu einem Beschwerderecht auf kantonaler Ebene, was wiederum eine Verrechtlichung<br />
darstellt. Das bedeutet in diesem Fall, dass ein gewisser „schwacher“ Rechtsanspruch auf Einbürgerung<br />
entsteht, wenn der Entscheid nicht diskriminierend oder willkürlich begründet werden<br />
kann. Zuvor konnte der Gesuchsteller nur Beschwerde ans Bundesgericht einreichen und dieses war<br />
wiederum eingeschränkt, denn es konnte nur die Verletzung der Verfahrensrechte prüfen. Auch die<br />
Einführung der höchstens kostendeckenden Gebühren per 1. Januar 2006 bedeutet eine Verrechtlichung,<br />
da sich damit eine gewisse Vereinheitlichung der Gebühren ergab. <strong>Die</strong> Ablehnung der SVP-<br />
Initiative „für demokratische Wahlen“, mit der Urnenabstimmungen wieder möglich gemacht werden<br />
sollten, durch das Volk am 1. Juni 2008 zeigt, dass die Mehrheit der Stimmenden die Bundesgerichtsentscheide<br />
vom 9. Juni 2003 akzeptiert hat und die bisherigen Schritte der Verrechtlichung grundsätzlich<br />
unterstützt. Auch die neusten Vorschläge zur Revision des Bürgerrechtsgesetzes liegen auf der<br />
Linie der festgestellten Tendenz zu einer Verrechtlichung. Hauptsächlich geht es bei diesen Vorschlägen<br />
um eine Vereinheitlichung, indem der Verfahrensablauf in den Kantonen vereinheitlicht werden<br />
soll. Aber auch die genaue Definition des Integrationsbegriffes stellt eine Vereinheitlichung dar.<br />
Jedoch unterstützte das Volk nicht nur die Stossrichtung des Bundesgerichtes und des Gesetzesgebers,<br />
sondern verhinderte auch eine weitere Verrechtlichung, indem die Stimmberechtigten am 26. September<br />
2004 gegen die Vorlage stimmten, welche die erleichterte Einbürgerung der zweiten und dritten<br />
Ausländergeneration in allen Kantonen vorsah. Durch die Annahme der Initiative wäre es zu einer<br />
Vereinheitlichung gekommen und es wäre auch ein gewisser Rechtsanspruch für die jungen Ausländer,<br />
welche die vorgegebenen Kriterien erfüllt hätten, entstanden.<br />
Einzelne Kantone (so insbesondere die Kantone Schwyz und Aargau) wehrten sich ausdrücklich gegen<br />
eine Verrechtlichung, vor allem gegen die Einschränkung der direkten Demokratie durch die beiden<br />
Bundesgerichtsentscheide. Da mit den Bundesgerichtsentscheiden vom 09. Juli 03 die Urnenabstimmungen<br />
untersagt worden waren, wollte der Kanton Schwyz sicherstellen, dass Entscheide über Einbürgerungen<br />
an Gemeindeversammlungen immer noch möglich sind. Das Bundesgericht stellte dies in<br />
seinem Entscheid vom 12. Mai 2004 sicher. 2007 wurde mit der Initiative Pfisterer die Zulässigkeit<br />
dieser Lösung gesetzlich verankert. <strong>Die</strong> Kantone können somit seit der Annahme der Initiative Pfisterer<br />
im Jahre 2008 selbständig über das Verfahren für die Einbürgerung entscheiden, was die Selbständigkeit<br />
der Kantone heraushebt. Dadurch gibt es viele unterschiedliche Verfahrensmöglichkeiten, was<br />
keine Vereinheitlichung darstellt und somit auch keine Verrechtlichung. Auch die Möglichkeit der Gemeindeversammlung<br />
bleibt bestehen, d.h. die Legislative der Gemeinde kann weiterhin die Einbürgerungsentscheide<br />
treffen. Daher bleibt die Einbürgerung teilweise ein politischer Akt. Es ist fraglich, ob<br />
die Abschaffung der Entscheidungszuständigkeit der Gemeindeversammlungen in einer Volksabstimmung<br />
angenommen worden wäre. Schon gegen das Verbot der Urnenabstimmung gab es heftige Proteste.<br />
Wäre auch die Entscheidungskompetenz der Gemeindeversammlung abgeschafft worden, hätte<br />
33