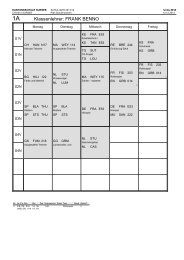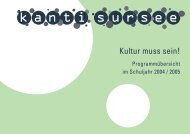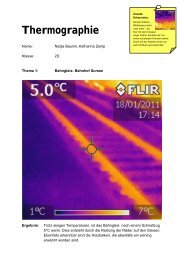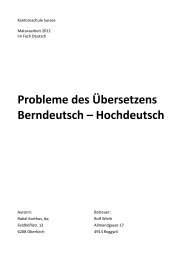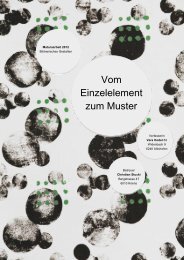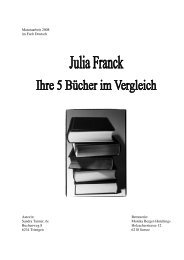Die ordentliche Einbürgerung - Sursee
Die ordentliche Einbürgerung - Sursee
Die ordentliche Einbürgerung - Sursee
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Maturaarbeit<br />
<strong>Die</strong> <strong>ordentliche</strong> Einbürgerung - Vom reinen Ermessensentscheid zum Rechtsanspruch<br />
Behinderung. 22 <strong>Die</strong>se Liste ist, wie in der Verwendung des Wortes „namentlich“ zum Ausdruck kommt,<br />
nicht abschliessend, sondern offen. Wenn jemand aufgrund eines Merkmals, das nicht in der Liste<br />
enthalten ist, diskriminiert wird, ist das auch unzulässig. Es muss aber nicht notwendigerweise eine<br />
Diskriminierung vorliegen, wenn eine Differenzierung auf Grund eines der genannten Kriterien oder<br />
eines anderen Kriteriums vorgenommen wird. Solche Ungleichbehandlungen vor dem Gesetz unterliegen<br />
jedoch einer besonderen qualifizierten Begründungspflicht. 23 Man kann daher Diskriminierung<br />
auch als eine starke Benachteiligung einer Person ohne eine sachliche und rechtfertigende Begründung<br />
definieren. 24<br />
Unzulässige Diskriminierungen sind auch in der Form der sogenannten indirekten Diskriminierung<br />
denkbar und verfassungsrechtlich unzulässig. Eine indirekte Diskriminierung zeichnet sich dadurch aus,<br />
dass auf den ersten Blick gar keine Diskriminierung vorliegt, indem eine Bestimmung neutral gefasst<br />
wird, sodass es so aussieht, als ob sie für alle gleich wirken würde. <strong>Die</strong> Bestimmung wirkt sich aber<br />
praktisch nur für bestimmte Menschen aus und wirkt auf diese Weise - trotz des neutralen Wortlauts,<br />
der an kein besonderes Merkmal eines Menschen anknüpft - diskriminierend. 25<br />
Gegen Diskriminierungen durch kommunale oder kantonale Behörden, wie sie beim Einbürgerungsverfahren<br />
vorkommen können, kann Beschwerde an das Bundesgericht eingereicht werden. 26<br />
b) Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 29 Abs. 2 BV)<br />
Nach Art. 29 Abs. 2 BV hat jeder Anspruch auf rechtliches Gehör. Das bedeutet, dass jeder, der in einem<br />
gerichtlichen Verfahren ist, das Recht hat, sich ausreichend zu informieren bzw. ausreichend über<br />
den Gegenstand und den Verlauf des Verfahrens orientiert zu werden. Zum Anspruch auf rechtliches<br />
Gehör gehört - wie schon der Name sagt - insbesondere aber auch das Recht, sich vor einem Entscheid<br />
zur Sache äussern und Anträge zum Verfahren und zur Sache stellen zu können. Zum Anspruch auf<br />
rechtliches Gehör zählt auch das Recht auf Einsicht in die Verfahrensakten. 27<br />
Das Bundesgericht hat in seiner Rechtsprechung ausserdem wiederholt festgehalten, dass aus dem<br />
Anspruch auf rechtliches Gehör auch die Begründungspflicht hervorgeht. 28 Erst durch eine Begründung<br />
wird ein behördlicher oder gerichtlicher Entscheid für den Bürger nachvollziehbar. Ausserdem ist<br />
die Begründung sehr wichtig, wenn man einen Entscheid anfechten will. Erst die Begründung macht es<br />
möglich, sich in einer Beschwerde mit dem Entscheid auseinanderzusetzen, indem man versucht zu<br />
zeigen, warum er falsch ist. 29<br />
c) Willkürverbot ( Art. 9 BV)<br />
„Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und<br />
Glauben behandelt zu werden“ (Art. 9 BV).<br />
Nach dem Bundesgericht ist ein Entscheid dann willkürlich, wenn er "grob unrichtig ist", sich „nicht auf<br />
ernsthafte, sachliche Gründe stützen lässt oder sinn- und zwecklos ist“. 30 Ein Entscheid ist nicht schon<br />
dann willkürlich, wenn die Begründung willkürlich ist. Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung<br />
ist ein Entscheid vielmehr erst dann willkürlich, wenn er im Ergebnis unhaltbar ist. 31 Das Bundesgericht<br />
22 Art 8 Abs. 2 BV.<br />
23 Rainer J. Schweizer, in: Kommentar BV, Art. 8 N 44.<br />
24 vgl. BGE 129 I 217 E. 2.1 S. 224.<br />
25 Rainer J. Schweizer, in: Kommentar BV, Art. 8 N 46. Als Beispiel kann etwa die Ungleichbehandlung von Teilzeitbeschäftigten<br />
gegenüber Vollzeitbeschäftigten genannt werden. Da auch heute noch überwiegend Frauen eine Teilzeitbeschäftigung<br />
ausüben, wirkt sich eine unterschiedliche Behandlung von Voll- und Teilzeitbeschäftigten vor allem zu Lasten der Frauen<br />
aus, obwohl das verwendete Kriterium (Teilzeitbeschäftigung) an sich neutral ist.<br />
26 BGE 129 I 217 E. 1.1 S. 220.<br />
27 Gerold Steinmann, in: Kommentar BV, Art. 29 N 24 f.<br />
28 BGE 129 I 232 E. 3.2 S. 236 f.; Gerold Steinman, in: Kommentar BV, Art. 29 N 27.<br />
29 Gerold Steinmann, in: Kommentar BV, Art. 29 N 27.<br />
30 Christoph Rohner, in: Kommentar BV, Art. 9 N 4 mit Hinweisen auf die bundesgerichtliche Rechtsprechung.<br />
31 Christoph Rohner, in: Kommentar BV Art. 9 N 5.<br />
9