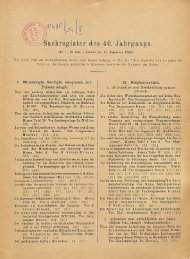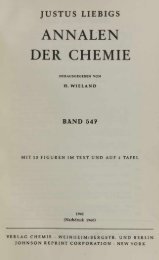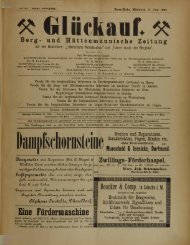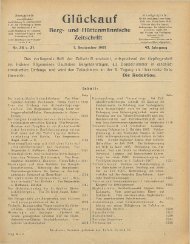GLÜCKAUF
GLÜCKAUF
GLÜCKAUF
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
1. Mai 1937 Glückauf 405<br />
Temperatur- und Wetterverhältnisse vor Ort<br />
in tiefen Gruben.<br />
Nr.<br />
Teufe<br />
m<br />
»C<br />
Gebirgstemperatur<br />
Lufttemperatur<br />
. . Naßken'<br />
w*ramdegrad<br />
«C °C<br />
m/s<br />
Wettergeschw.<br />
Trokken<br />
Naß-<br />
kühl« tärke<br />
Bemerkungen<br />
1 825 37,0 25,6 17,8 1,65 3,9 30,0 Ortshöhe 1,65 m, 27 m v.<br />
2 840 37,0 27,0 18,5 1,15 - 26,2<br />
d. Wettereinzugstrecke<br />
Dasselbe Flöz, Entferng.<br />
3 840 37,0 33,3 22,2 4,15 - 31,5<br />
145 m, 300 ms Luft/min<br />
Dasselbe Flöz, freier<br />
4 860 38,0 30,6 23,5 0,65 - 16,4<br />
W etterquerschnitt 3 m2<br />
1,35-m-Flöz, Entfernung<br />
165 m vom E.-Schacht<br />
5 880 38,5 37,8 23,3 1,15 - 19,2 1,5-mFlöz<br />
6 825 37,0 34,6 23,6 3,25 - 26,8 1,25-m-Flöz, Abbau<br />
7 900 39,0 38,3 26,0 0,30 - 11,2<br />
nicht mechanisiert<br />
Messung zwischen<br />
8 1170 46,0 36,1 25,6 0,55 - 14,0<br />
2 Bergemauern<br />
0,9-m-Flöz, 75 m von<br />
9 900 39,0 37,3 25,6 2,22 - 20,8<br />
Einziehstrecke<br />
1,65-m-Flöz, W ettermenge<br />
10 1170 46,0 37,5 27,0 0,90 - 13,7 565 in2 min<br />
W etterabzugstrecke im<br />
0,9-m-Flöz<br />
11 840 39,0 36,7 26,7 1,85 - 19,2 Dasselbe im 1,3-m-Flöz<br />
12 1020 42,0 37,2 27,2 0,50 - U,9 0,85-m-Flöz, freier Ortsquerschnitt<br />
13 1060 43,0 38,3 26,3 2,00 - 16,0 3,8 m2<br />
W ettereintr. 0,9-m-Flöz,<br />
W ettermenge 270 m3/min<br />
14 1150 45,5 41,1 27,8 0,20 - 7,0 0,85-m-Flöz<br />
15 1150 45,5 41,1 27,8 0,65 - 12,0 Dasselbe Flöz<br />
16 720 31,0 28,8 28,0 2,12 - 17,0 1,2-m-Flöz, W ettermenge<br />
370 m3/min<br />
17 1040 42,0 39,8 28,5 0,85 - 11,5 Ort nicht belegt, W etterabzugseite<br />
18 1150 45,5 39,1 28,6 2,10 - 14,4 0,9-m-Flöz<br />
Wettereintrittseite in<br />
0,85-m-Flöz<br />
19 850 35,5 31,1 28,9 1,45 - 11,9 Dasselbe im 1,35-m-Flöz<br />
20 1130 45,0 39,7 29,4 1,40 - 11,3 Wetterabzugseite in<br />
21 850 35,5 31,1 29,4 0,85 - 9,0<br />
einem 0,85-m-Flöz<br />
1,35-m-FIöz<br />
22 730 32,0 31,7 30,0 0,70 2,9 8,4 1,2-m-Flöz, sehr naß<br />
23 1150 45,5 40,8 30,0 1,10 — 10,0 0,85-m-Flöz<br />
24 850 35,5 32,8 30,6 1,05 — 8,0 1,35-m-Flöz<br />
25 1150 45,5 40,9 31,3 1,00 — 7,7 ln ein. 0,85-m-Flöz, 100m<br />
v. Wettereinzugstollen<br />
26 850 35,5 32,8 30,9 1,60 — 8,5 Wetterabzugseite eines<br />
1,35-m-Flözes<br />
27 1160 45,5 40,9 31,9 1,25 7,8 W etterabzugseite eines<br />
160 m langen Strebs,<br />
Flözmächtigkeit 0,85 m<br />
war so hoch, daß die Leute mit entblößtem Oberkörper<br />
arbeiteten. Die Messungen wurden einmal an der Wettereintrittseite<br />
während des Auskohlens vorgenommen und<br />
später wiederholt, nachdem die Leute am Schichtende das<br />
Ort verlassen hatten; es ergab sich folgendes Gesamtbild.<br />
1. Belegschaft vor Ort: an der Wettereintrittstelle Trockentemperatur<br />
39,6°, Naßwärmegrad 26°, Naßkühlstärke 9;<br />
an der Wetterabzugstelle Trockentemperatur 39,8°, Naßwärmegrad<br />
31°, Naßkühlstärke 7,5; Wettergeschwindigkeit<br />
0,95 m/s. 2. Niemand vor Ort: an der Wettereintrittstelle<br />
wie vorher; an der Wetterabzugstelle Trockentemperatur<br />
39,7°, Naßwärmegrad 28,7°, Naßkühlstärke 11,5; Wettergeschwindigkeit<br />
0,85 m/s.<br />
Der festgestellte Unterschied zwischen den Naßwärmegraden<br />
beträgt bei beiden Beobachtungen 2,3° C, was einer<br />
Abnahme der relativen Feuchtigkeit um 11 °/o entspricht<br />
und zweifellos zum großem Teil auf die Schweißverdunstung<br />
im ersten Falle zurückzuführen und bei der<br />
Abbauplanung auf heißen Gruben in Betracht zu ziehen ist.<br />
Das vermehrte Freilegen frischer Kohle infolge der<br />
Steigerung des Verhiebfortschrittes ist für die Temperaturverhältnisse<br />
gleichfalls von Bedeutung, wie zwei in<br />
einem Streb von 155 m Länge eines 0,9-m-Flözes angestellte<br />
Meßreihen zeigten. Bei der ersten bestand die<br />
Belegung aus 30 Mann, die Verhiebgeschwindigkeit betrug<br />
1,35 m/Tag. Gemessen wurden: am Wettereintritt<br />
Trockentemperatur 39,2°, Naßwärmegrad 28,7°, Naßkühlstärke<br />
13,5, Wettergeschwindigkeit 1,55 m/s; am Wetteraustritt<br />
Trockentemperatur 40,8°, Naßwärmegrad 30°,<br />
Naßkühlstärke 10, Wettergeschwindigkeit 1,10 m/s. Eine<br />
Woche später war die Verhiebgeschwindigkeit auf 1,8 m<br />
je Tag und die Belegung auf 42 Mann erhöht worden.<br />
Die entsprechenden Meßergebnisse lauteten: am Wettereintritt<br />
Trockentemperatur 39,4°, Naßwärmegrad 28,7°,<br />
Naßkühlstärke 14,4, Wettergeschwindigkeit 2,10 m/s; am<br />
Wette raustritt Trockentemperatur 41°, Naßwärmegrad<br />
28,7°, Naßkühlstärke 7,7. Die letzten Ermittlungen lassen<br />
keinen Zweifel darüber aufkommen, daß die Wetterverhältnisse<br />
eine Verschlechterung erfahren haben, die allerdings<br />
zum Teil mit der Erhöhung der Ortsbelegschaft zusammenhängt<br />
und damit auch die Ausführungen des vorigen Abschnittes<br />
bekräftigt. Eine genaue Festlegung des auf den<br />
raschem Verhieb und auf die stärkere Belegung entfallenden<br />
Anteils ist allerdings nicht möglich.<br />
Nachdem die vor 30 Jahren angenommene 1200-ni-<br />
Grenze erreicht ist, könnte sich die Frage nach einer<br />
Schätzung der Teufe erheben, in der die atmosphärischen<br />
Bedingungen eben noch das Erzielen der für einen wirtschaftlichen<br />
Betrieb erforderlichen Leistung gestatten. Wie<br />
sich bei der Entwicklung der verschiedenen Einrichtungen<br />
und Hilfsmittel für die Wetterversorgung und -kühlung,<br />
z. B. in Südafrika, gezeigt hat, lassen sich die weitem Verbesserungsmöglichkeiten<br />
noch nicht absehen; die Angabe<br />
irgendwelcher Zahlen wäre daher zwecklos.<br />
Auf Grund der bei den geschilderten Beobachtungen<br />
gemachten Erfahrungen l^ann man nachstehende Schlüsse<br />
ziehen: 1. Die Hauptwetterwege sollen möglichst wenig<br />
Krümmungen, aber große Querschnitte aufweisen. 2. Bei<br />
der Vorrichtung ist darauf Bedacht zu nehmen, daß sich<br />
der Haupteinziehstrom erst möglichst dicht am Abbau in<br />
Teilströme verzweigt. 3. Die von einem Teilstrom bewetterte<br />
Streblänge ist herabzusetzen, was allerdings<br />
höhere Gesamtwettermengen erforderlich macht. 4. Der<br />
Versatz ist besonders in mächtigen Flözen recht dicht nachzuführen,<br />
damit die Wettergeschwindigkeit nicht sinkt.<br />
5. Die Gewinnung ist weitgehend zu mechanisieren. 6. Das<br />
Einbringen des Versatzes soll möglichst maschinenmäßig<br />
erfolgen; andernfalls ist für eine ausreichende Bewetterung<br />
der Arbeitsplätze im Versatzbetriebe zu sorgen. 7. Für eine<br />
wirksame Niederschlagung des Staubes müssen auch bei<br />
hohen Wettergeschwindigkeiten Vorkehrungen getroffen<br />
werden. 8. Die Fahrstrecken sind gesondert von den Hauptförder-<br />
bzw. Wetterein- und -ausziehstrecken anzulegen.<br />
Dipl.-Ing. H. Pohl, Breslau.<br />
Deutsche Geologische Gesellschaft.<br />
Sitzung am 7. April 1937. Vorsitzender: Geh. Bergrat<br />
Range.<br />
Professor Dr. Endell, Berlin, berichtete über Reiseeindrücke<br />
in Brasilien (Bodenbildung, Eisen- und<br />
Manganerze). Der Vortragende hat im Landwirtschaftlichen<br />
Institut von Säo Paulo ein für Zwecke der Boden,-<br />
untersuchung bestimmtes Röntgengerät vorgeführt, mit<br />
dem vor allem die Zusammensetzung der Terra rossa<br />
(Roterde) untersucht werden soll, da dieser Boden für die<br />
Kaffeeanpflanzungen Brasiliens von großer Bedeutung ist.<br />
Das Gerät soll die mineralische Natur des adsorbierenden<br />
Bodenkomplexes erkennen lassen. Weiterhin ging der Vortragende<br />
kurz auf seine bekannten Ansichten über den<br />
Montmorillionit, den Bentonit und den Kaolinit ein.<br />
In der beginnenden Regenzeit unternahm er einige<br />
Fahrten in das Innere des Landes und stieß dabei auf<br />
Vorkommen der bislang in Brasilien unbekannten Kieselgur.<br />
Diese Vorkommen werden in geringem Umfange zur<br />
Herstellung von Dachziegeln ausgebeutet, aus deren Verbreitung<br />
zu erkennen ist, daß größere Lager im Innern<br />
des Landes vorhanden sein müssen.<br />
In Minas Geraes besichtigte er die Itabiritvorkommen.<br />
Die Verhüttung der Erze wird aus Mangel an Steinkohle<br />
mit Holzkohle vorgenommen. Zu deren Gewinnung sind<br />
große Flächen Urwald abgeholzt worden, die nun kahl<br />
liegen und auf denen sich Flugsande anhäufen, so daß jede<br />
Nutzung des Bodens dadurch verhindert wird. Das Land