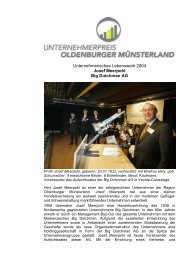Land mit Aussicht - Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung
Land mit Aussicht - Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung
Land mit Aussicht - Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Dennoch beruht die große Zunahme weiblicher<br />
Erwerbspersonen vorrangig auf<br />
unsicheren Arbeitsverhältnissen wie geringfügig<br />
bezahlter Arbeit (Mini-Jobs), nicht<br />
sozialversicherungspflichtiger Teilzeitarbeit<br />
oder selbstständiger Beschäftigung etwa als<br />
<strong>mit</strong>helfende Familienangehörige. 6<br />
Diese Arbeitsverhältnisse sind durchaus<br />
vereinbar <strong>mit</strong> dem traditionellen Familienmodell,<br />
welches in der Region nach wie vor<br />
häufig gelebt wird. Die daran geknüpfte Kinderbetreuung,<br />
die überwiegend die Mütter<br />
leisten, erfährt eine hohe Wertschätzung <strong>und</strong><br />
wird als gleichwertig <strong>mit</strong> einer Erwerbsarbeit<br />
angesehen. Demnach stehen öffentliche<br />
Betreuungsangebote auch nur im geringem<br />
Maße zur Verfügung, wobei unklar ist, ob dies<br />
auf einem mangelnden Angebot oder einer<br />
fehlenden Nachfrage beruht.<br />
Das traditionelle Familienmodell überschneidet<br />
sich <strong>mit</strong> der besonderen Rolle<br />
der katholischen Religion im Oldenburger<br />
Münsterland. Zwar machen die b<strong>und</strong>esweit<br />
zu verzeichnenden Säkularisierungstendenzen<br />
auch vor dem Oldenburger Münsterland<br />
nicht halt, dennoch bekennt sich immer noch<br />
ein Großteil der hier lebenden Menschen zum<br />
katholischen Glauben. Im Jahr 2006 waren<br />
es im <strong>Land</strong>kreis Vechta 65 Prozent <strong>und</strong> im<br />
<strong>Land</strong>kreis Cloppenburg knapp 63 Prozent der<br />
Bevölkerung, das sind mehr als doppelt so<br />
viel wie im deutschen Mittel. 7<br />
Die andauernde Bedeutung der Religion <strong>und</strong><br />
vor allem ihrer Wertvorstellungen schlägt<br />
sich auch im Wahlverhalten nieder. Die<br />
Olden burger Münsterländer wählen seit jeher<br />
christlich-konservativ: Vor dem Zweiten<br />
Weltkrieg die Deutsche Zentrumspartei 8 <strong>und</strong><br />
später die CDU, deren Stimmenanteil bei den<br />
Kommunal-, <strong>Land</strong>tags- <strong>und</strong> B<strong>und</strong>estagswahlen,<br />
aber auch bei den Europawahlen seit den<br />
1950er Jahren konstant hoch liegt.<br />
Was charakterisiert ländliche Räume?<br />
Angesichts der demografischen <strong>und</strong> wirtschaftlichen<br />
Besonderheiten des Oldenburger<br />
Münsterlandes stellt sich die Frage, wie<br />
stark sich diese <strong>Entwicklung</strong>en von anderen<br />
ländlich geprägten Räumen in Deutschland<br />
unterscheidet.<br />
Ländliche Räume wurden lange Zeit <strong>und</strong> zum<br />
Teil bis heute allein in Abgrenzung zur Stadt<br />
definiert. Mit den Gegenpolen von Stadt<br />
<strong>und</strong> <strong>Land</strong> – letzteres oftmals gleichgesetzt<br />
<strong>mit</strong> dem Bild des „Dorfes“ – gingen dabei<br />
unterschiedliche Assoziationen einher, etwa<br />
der strukturelle <strong>Entwicklung</strong>sbedarf des<br />
ländlichen Raumes gegenüber der Stadt, aber<br />
auch eine Romantisierung des idyllischen<br />
<strong>Land</strong>lebens. Dass man jedoch weder von dem<br />
ländlichen Raum sprechen kann, noch, dass<br />
„Ruralität […] gleichbedeutend <strong>mit</strong> Niedergang“<br />
9 ist, zeigt der OECD-Bericht „Das neue<br />
Paradigma für den ländlichen Raum“ aus<br />
dem Jahr 2006: Demzufolge zeichnen sich<br />
ländliche Räume ganz im Gegenteil durch<br />
eine bemerkenswerte Vielfalt in ihrer Kultur,<br />
Struktur oder Bevölkerungs- <strong>und</strong> Wirtschaftsentwicklung<br />
aus. Längst ist <strong>Land</strong>wirtschaft<br />
nicht mehr der Maßstab für Ländlichkeit.<br />
Um diese zu definieren, nutzt die OECD vor<br />
allem zwei Kriterien: zum einen die Bevölkerungsdichte<br />
<strong>und</strong> zum anderen die relative<br />
Entlegenheit. Unterscheiden lassen sich demnach<br />
vorwiegend ländliche, intermediäre <strong>und</strong><br />
vorwiegend städtische Regionen. Bezogen<br />
auf die Bevölkerungsdichte sind Regionen<br />
vorwiegend ländlich, wenn über 50 Prozent<br />
ihrer Bevölkerung in ländlichen Gemeinden<br />
leben, intermediär, wenn der Anteil zwischen<br />
15 <strong>und</strong> 50 Prozent liegt. Ländlich ist eine<br />
Gemeinde dann, wenn in ihr höchstens 150<br />
Einwohner je Quadratkilometer leben. Fehlt<br />
ein großes städtisches Zentrum, ist das zweite<br />
Kriterium erfüllt.<br />
Fasst man die <strong>Land</strong>kreise Cloppenburg <strong>und</strong><br />
Vechta zum Oldenburger Münsterland zusammen,<br />
dann ist die Region als vorwiegend<br />
ländlich einzustufen, betrachtet man sie<br />
getrennt voneinander, so gilt diese Zuordnung<br />
lediglich für Cloppenburg. Im <strong>Land</strong>kreis<br />
Vechta leben nur 29 Prozent der Bevölkerung<br />
in ländlichen Gemeinden. Er ist da<strong>mit</strong> als<br />
intermediär zu bezeichnen.<br />
Die OECD sieht den Großteil der ländlichen<br />
Regionen vor vier Herausforderungen: Die<br />
Abwanderung von jungen Menschen <strong>und</strong> die<br />
da<strong>mit</strong> verb<strong>und</strong>ene Alterung der Gesellschaft;<br />
ein niedriges Bildungsniveau der Bevölkerung;<br />
eine geringe durchschnittliche Arbeitsproduktivität;<br />
sowie ein insgesamt niedriges<br />
öffentliches Dienstleistungsangebot.<br />
Regionen, die nur bedingt von diesen Problemen<br />
betroffen sind oder erfolgreiche Wege<br />
zur Bewältigung gef<strong>und</strong>en haben, sind vor<br />
allem dort zu finden, wo es gelungen ist,<br />
„aus öffentlichen oder quasi-öffentlichen<br />
Gütern wie sauberer Umwelt, attraktivem<br />
<strong>Land</strong>schaftsbild oder Kulturerbe (einschließlich<br />
Esskultur) Kapital zu schlagen“. 9 Folglich<br />
können auch Regionen, die Kraft ihrer natürlichen<br />
Umwelt oder ihres Kulturangebotes<br />
Touristen anlocken, trotz Entlegenheit <strong>und</strong><br />
geringer Bevölkerungsdichte wirtschaftlich<br />
<strong>und</strong> demografisch stabil sein.<br />
Kapitel 1<br />
<strong>Berlin</strong>-<strong>Institut</strong> 9