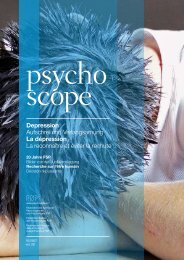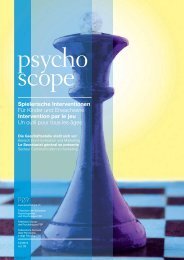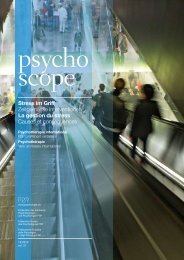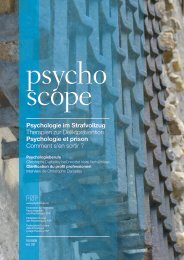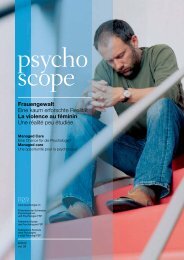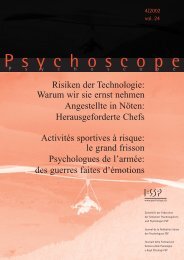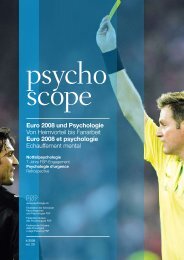PSC 6-01 - FSP
PSC 6-01 - FSP
PSC 6-01 - FSP
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
P s y c h o s c o p e 6 / 2 0 0 1 6/7<br />
1. Psycho-Diagnostik<br />
spielt in<br />
meinem Berufsalltag eine gewichtige<br />
Rolle. Ich wende sie ausführlich an,<br />
wenn ich forensische Begutachtungen<br />
erstelle, brauche sie aber auch, um<br />
Ansätze in der Psychotherapie zu finden<br />
und um Veränderungen durch<br />
Psychotherapien zu belegen. Der Bedarf<br />
nach solchen Aussagen ist in der<br />
Gesellschaft gross und wächst weiter.<br />
2. Die Fragestellungen in der forensischen<br />
Beurteilung beziehen sich meist<br />
auf die Einschätzung der Persönlichkeit,<br />
aber auch der Glaubhaftigkeit von<br />
Aussagen, der Beurteilung von Delikten<br />
und der Rückfallgefahr. Je nach<br />
Klient und Fragestellung werden verschiedene<br />
psychologische Testbatterien<br />
angewandt, die Aussagen über intellektuelles<br />
Leistungsvermögen, neuropsychologisches<br />
Hirnleistungsprofil und<br />
auch über allgemeine Persönlichkeitsmerkmale<br />
machen können. Alle Resultate<br />
müssen ein einheitliches Bild ergeben<br />
und auch mit den ausführlichen<br />
Interviews vereinbar sein.<br />
3. NichtpsychologInnen – aber auch<br />
manche PsychologInnen – zeichnen<br />
sich durch allzu grosse Testgläubigkeit<br />
aus. Sie verwenden oft nur einzelne<br />
Tests und nehmen das Resultat unbesehen<br />
als Realität, ohne es weiter in einen<br />
grösseren Kontext zu stellen. Sie haben<br />
meist zu wenig Einsicht darin, wie<br />
Tests beschaffen sind und was sie wirklich<br />
messen. Ihre unkritische Vorgehensweise<br />
bildet denn auch den Boden<br />
für die KritikerInnen der Psychodiagnostik.<br />
Beide Gruppen beziehen sich<br />
gerne aufeinander.<br />
4. Nachdem Jugendzeitschriften und<br />
Magazine dauernd irgendwelche Fragebogentests<br />
durchführen, in denen der<br />
Leser über sich etwas erfahren soll,<br />
sind Tests Bestandteil unseres Alltags<br />
geworden. Sie sind damit selbstverständlicher<br />
geworden – und werden<br />
weniger ernst genommen.<br />
Dr. phil. Hans-Werner Reinfried,<br />
Fachpsychologe für Klinische<br />
Psychologie und Psychotherapie <strong>FSP</strong>,<br />
Rechtspsychologe SGRP<br />
1. Für mich als<br />
Schulpsychologin<br />
hat die Psycho-Diagnostik nach wie vor<br />
einen sehr hohen Stellenwert im professionellen<br />
Beratungsprozess. Je nach<br />
Fragestellung werden mehr oder weniger<br />
psychodiagnostische Verfahren und<br />
Tests eingesetzt, ist die diagnostische<br />
Phase länger oder kürzer.<br />
2. Ich werde häufig bei Fragen zu<br />
Lern- und Leistungsschwierigkeiten<br />
beigezogen. Auf der Suche nach<br />
Antworten greife ich dann auch zu den<br />
gängigen Intelligenz- und Leistungstests.<br />
Zuerst wird jedoch immer – und<br />
das ist mir sehr wichtig – eine ausführliche<br />
Ressourcenexploration durchgeführt.<br />
Hier kommen diagnostische<br />
Instrumente zum Einsatz, wie z.B.<br />
Befragung der Eltern und Lehrpersonen,<br />
Interessen-, Persönlichkeitsfragebogen<br />
und -tests sowie Zeichnungen.<br />
3. Psychologische Tests gehören unbedingt<br />
in die Hände von erfahrenen<br />
Fachleuten, d.h. von PsychologInnen,<br />
die in Testdiagnostik ausgebildet sind.<br />
NichtpsychologInnen neigen dazu, die<br />
Testresultate eindimensional zu interpretieren.<br />
Tests geben immer nur Teilinformationen.<br />
Im professionellen psychodiagnostischen<br />
Prozess werden die<br />
Informationen aus verschiedenen Quellen<br />
zueinander in Beziehung gesetzt,<br />
was zur Lösungssuche beitragen soll.<br />
4. Nein, die Skepsis ist aus meiner<br />
Sicht nicht geringer geworden, aber die<br />
Erwartungen an die Tests und ihre<br />
Aussagekraft sind unterschiedlich<br />
gross. Einerseits sollen die Testresultate<br />
Antworten auf die Ursache einer<br />
Lernstörung liefern. Andererseits werden<br />
die Testresultate angezweifelt oder<br />
überinterpretiert. Auch die eigene<br />
Testerfahrung spielt eine wichtige<br />
Rolle.<br />
lic. phil. Marlis Eeg, Fachpsychologin<br />
für Kinder- und Jugendpsychologie<br />
<strong>FSP</strong>, Schulpsychologischer Dienst des<br />
Kantons St. Gallen<br />
1. Der Einsatz von<br />
diagnostischen<br />
Instrumenten hat in der Sportpsychologie<br />
begleitenden Charakter. In<br />
Forschungsprojekten werden deren<br />
Testgütekriterien überprüft. In der<br />
praktischen Beratungstätigkeit werden<br />
sie in Ergänzung zum diagnostischen<br />
Gespräch verwendet. Eine steigende<br />
Tendenz kann kaum festgestellt werden.<br />
Zudem zeigt sich beim Einsatz im<br />
Spitzensportbereich ein Problem: Bei<br />
SpitzensportlerInnen handelt es sich in<br />
der Regel um gesunde Individuen einer<br />
besonderen Population. Das macht die<br />
Verwendung von Normen schwierig.<br />
2. Die interessierenden Variablen sind<br />
sehr unterschiedlich. Oft stellt sich die<br />
Frage nach den mentalen Fertigkeiten,<br />
über welche ein Athlet verfügt, oder es<br />
interessiert das Monitoring der Erholungs-Beanspruchungsbilanz<br />
von<br />
SportlerInnen.<br />
3. Die Verwendung diagnostischer<br />
Instrumente durch nicht geschulte<br />
Personen beinhaltet die Gefahr der<br />
Überinterpretation oder Falschinterpretation.<br />
Vor allem eine kritische<br />
Begutachtung der Testgütekriterien ist<br />
unabdingbar. Zusätzlich scheint mir die<br />
Einbettung in ein «psychologisch»<br />
geprägtes Menschenbild sehr wichtig.<br />
4. Schwierig zu beantworten. Einerseits<br />
erfreuen sich computergestützte Testinstrumente<br />
grosser Beliebtheit (obwohl<br />
deren Transfermöglichkeiten eingeschränkt<br />
sind). Andererseits haben<br />
die SportlerInnen Mühe mit dem Ausfüllen<br />
von Fragebögen. SportlerInnen<br />
möchten einen pragmatischen Nutzen<br />
beim Einsatz von Psycho-Diagnostik<br />
sehen. Beim Monitoring der Erholungs-<br />
Beanspruchungbilanz wird dieser<br />
Nutzen jedoch erst bei einer ungewollten<br />
Negativbilanz sichtbar, was aus der<br />
Sicht der SportlerInnen glücklicherweise<br />
eher ausnahmsweise der Fall ist, den<br />
Sinn dieser Psychodiagnostik jedoch<br />
nur selten direkt sichtbar macht.<br />
lic. phil. Daniel Birrer, Psychologe<br />
<strong>FSP</strong>, Sportwissenschaftliches Institut,<br />
Bundesamt für Sport