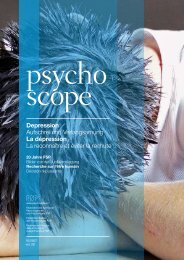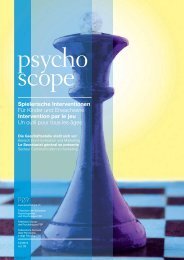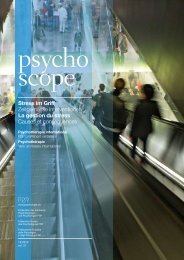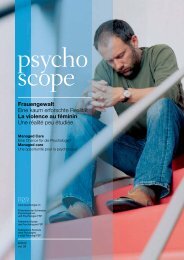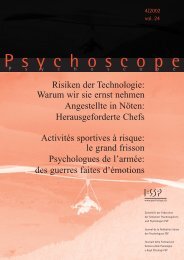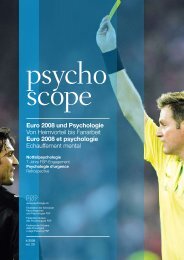PSC 10-08 - FSP
PSC 10-08 - FSP
PSC 10-08 - FSP
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
erhebliche Substanzabhängigkeit. In betrunkenem<br />
Zustand beging er mehrere Vergewaltigungen an<br />
jungen, ihm unbekannten Frauen. In der Therapie<br />
zeigte er sich geplagt von massiven Schuldgefühlen<br />
wegen seiner Delikte, die er sehr ich-dyston erlebte.<br />
Nach mehrmonatiger Einzeltherapie war er imstande,<br />
sich in der Deliktrekonstruktion mit seinen Taten<br />
auseinanderzusetzen. Innerfamiliäre Konflikte, insbesondere<br />
mit einem durch den Krieg traumatisierten<br />
und in der Schweiz nie wirklich integrierten Vater,<br />
Konflikte und Diskriminierung am Arbeitsplatz bei<br />
gleichzeitiger Überanpassung erwiesen sich als belastende<br />
Faktoren. Schliesslich war er zunehmend in der<br />
Lage, sich mit Problembereichen wie Abhängigkeit,<br />
Dominanzverhalten, Kränkungen und Wut auseinanderzusetzen.<br />
Schlussbemerkung<br />
Die psychotherapeutische Arbeit mit Tätern gestaltet<br />
sich meist vielschichtig und langfristig. Einige Klienten<br />
erkennen im Laufe der Therapie mit grosser Betroffenheit,<br />
dass es tragischerweise eines Delikts bedurfte,<br />
um sie zu einer Therapie zu führen, die ihnen einen<br />
rücksichtsvollen Umgang mit sich selbst und ihren<br />
Mitmenschen eröffnete. Andere Klienten können oder<br />
wollen sich nicht mit sich und ihrer Vergangenheit<br />
auseinandersetzen. Vom Therapeuten, der dem Klienten<br />
sowie der einweisenden Behörde regelmässig eine professionelle<br />
Einschätzung des Therapieverlaufs und des<br />
Rückfallrisikos gibt, ist in allen Fällen eine transparente<br />
Haltung gefragt. Welches Rückfallrisiko und<br />
welches Gefahrenpotenzial tragbar sind, bleibt dabei<br />
letztlich eine Frage, die immer wieder gesellschaftlich<br />
neu diskutiert und beantwortet werden muss. Tätertherapie<br />
und die Behandlung von traumatischen Erfahrungen<br />
vieler Täter sollen keiner Bevorzugung gegenüber<br />
ihren Opfern dienen. Die allermeisten Täter verbüssen<br />
eine zeitlich befristete Freiheitsstrafe. Im Sinne<br />
von Opferschutz und Deliktprävention ist daher nach<br />
Möglichkeit die Zeit im Strafvollzug zu nutzen und<br />
darauf hinzuarbeiten, dass der Täter bei einer Entlassung<br />
sich und seine Vergangenheit soweit im Griff<br />
hat, dass nicht erneut andere Menschen zum Opfer<br />
werden.<br />
Ueli Christoffel und Frank Schönfeld<br />
Bibliografie<br />
Endrass J., Rossegger A., Urbaniok F. (2007): Zürcher<br />
Forensik Studie. Abschlussbericht zum Modellversuch.<br />
«Therapieevaluation und Prädiktorenforschung».<br />
http://www.zurichforensic.org<br />
Endrass J., Rossegger A., Noll T., Urbaniok F. (2007):<br />
Wirksamkeit von Therapien bei Gewalt- und Sexualstraftätern.<br />
Psychiatrische Praxis. 35(1): 8–14.<br />
Endrass J., Vetter S., Urbaniok F., Elbert T., Rossegger A.<br />
(2007): The prevalence of early victimization among<br />
violent and sexual offenders in Switzerland. International<br />
Perspectives in Victimology. 3(2): 24–30.<br />
Urbaniok F. (2003): Der deliktorientierte Therapieansatz in<br />
der Behandlung von Straftätern – Konzeption, Methodik<br />
und strukturelle Rahmenbedingungen im Züricher PPD-<br />
Modell. Psychotherapie Forum 11(4): 202–213.<br />
Urbaniok F., Endrass J., Noll T., Vetter S., Rossegger A.<br />
(2007): Posttraumatic stress disorder in a Swiss offender<br />
population. Swiss Medical Weekly 137(9-/<strong>10</strong>): 151–156.<br />
Die Autoren<br />
Lic. phil. Ueli Christoffel, Fachpsychologe für Psychotherapie<br />
<strong>FSP</strong> und leitender Psychologe, arbeitet seit 1999 im<br />
Psychiatrisch-Psychologischen Dienst des Justizvollzugs<br />
im Kanton Zürich.<br />
Lic. phil. Frank Schönfeld, Psychologe, arbeitet seit 2000<br />
im Psychiatrisch-Psychologischen Dienst des Justizvollzugs<br />
im Kanton Zürich. Er ist ausgebildet als Körperpsychotherapeut<br />
IBP (Integrated Body Psychotherapy). Neben<br />
seiner therapeutischen Tätigkeit leitet er das Ressort<br />
Neuropsychologie.<br />
Anschrift<br />
Lic. phil. Ueli Christoffel<br />
Lic. phil. Frank Schönfeld<br />
Psychiatrisch-Psychologischer Dienst<br />
Justizvollzug Kanton Zürich<br />
Feldstrasse 42<br />
8090 Zürich<br />
ueli.christoffel@ji.zh.ch<br />
frankolaf.schoenfeld@ji.zh.ch<br />
Résumé<br />
Dans le plus grand établissement pénitentiaire de Suisse<br />
(la Pöschwies de Zurich) et dans le Service ambulatoire<br />
de psychiatrie et psychologie (PPD) de l’Office d’exécution<br />
des peines du canton de Zurich, des centaines de<br />
délinquants ont déjà suivi des traitements de psychothérapie.<br />
A lire Ueli Christoffel, lic. phil. et psychologue<br />
responsable du PPD, et son collègue Frank Schönfeld,<br />
lic. phil. et psychologue au PPD, l’efficacité préventive<br />
de la psychothérapie n’est plus à démontrer. Les deux<br />
auteurs décrivent dans leur article les particularités de la<br />
psychothérapie du délinquant, une psychothérapie bifocale,<br />
centrée sur la personnalité, pendant et après l’exécution<br />
de la peine. Vu la durée limitée de la plupart des<br />
peines, il serait judicieux d’utiliser de manière optimale<br />
le temps d’exécution de la peine dans une perspective<br />
de protection des victimes et de prévention.<br />
11