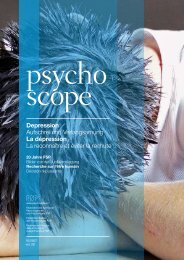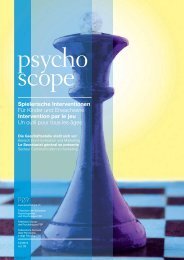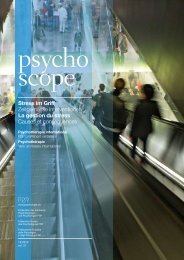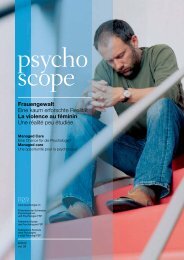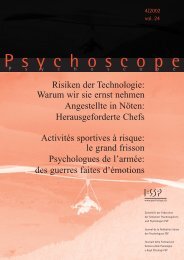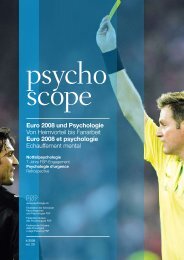PSC 10-08 - FSP
PSC 10-08 - FSP
PSC 10-08 - FSP
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
• Fremdbestimmung:<br />
Das übergeordnete Therapieziel wird nicht zwischen<br />
der Therapeutin und dem Delinquenten ausgehandelt,<br />
sondern ist vom Gesetzgeber vorgegeben. Im<br />
Vordergrund steht dabei nicht das psychische Wohlergehen<br />
des Delinquenten, sondern die psychische<br />
Störung soll behandelt werden, damit der Delinquent<br />
in der Lage ist, fremdschädigende Handlungen zu<br />
unterlassen. Der Behandlungsauftrag dient vor allem<br />
dazu, gesellschaftlichen Schaden zu verhindern. Die<br />
PsychotherapeutInnen sind aber auch dem delinquenten<br />
Menschen verpflichtet und müssen die Behandlung<br />
so ausrichten, dass ihm in Zukunft ein deliktfreies<br />
Leben möglich wird. Fachpersonen, die mit<br />
delinquenten Menschen arbeiten, müssen sich dieser<br />
Doppelrolle bewusst und diesbezüglich dem Delinquenten<br />
gegenüber transparent sein.<br />
Die Behörden, die mit dem Vollzug der Massnahmen<br />
beauftragt sind, stützen ihre Entscheidungen auf<br />
Verlaufsberichte der behandelnden Fachpersonen.<br />
Sie sind aber befugt oder haben in bestimmten Fällen<br />
sogar die Pflicht, externe Sachverständige beizuziehen.<br />
Diese geben Empfehlungen zu allfälligen<br />
weiteren Massnahmen ab, die das Rückfallrisiko vermindern<br />
sollen. Therapiebeginn und Therapieabschluss<br />
sind bei Psychotherapien im Massnahmenvollzug<br />
ebenfalls fremdbestimmt.<br />
• Sorgfaltspflicht:<br />
Die Behandlungsplanung stützt sich nicht nur auf<br />
die Aussagen des Delinquenten, diesen wird nicht<br />
unbedingt geglaubt. Die Therapeutin muss in Kauf<br />
nehmen, dass ein Delinquent es als sein Recht betrachtet,<br />
bewusst zu lügen, um sich so Vorteile zu<br />
verschaffen.<br />
Es kann auch sein, dass er – aufgrund seiner Sozialisation<br />
oder seiner psychischen Störungen – einen lockeren<br />
Umgang mit der Wahrheit pflegt. Vielleicht<br />
ist er noch nicht in der Lage, sich das Ausmass seines<br />
Vergehens oder seiner Defizite einzugestehen. Es<br />
gehört deshalb zur beruflichen Sorgfalt, vorhandenes<br />
Aktenmaterial sorgfältig zu studieren: dazu gehören<br />
Gerichtsakten, psychiatrische Gutachten, allenfalls<br />
Verhörprotokolle. Ebenso nehmen die PsychotherapeutInnen<br />
an regelmässigen Fallbesprechungen<br />
mit anderen Fachpersonen eines multidisziplinären<br />
Teams teil.<br />
• Schweigepflicht:<br />
Die Schweigepflicht der Therapeutinnen ist eingeschränkt.<br />
Sie müssen in regelmässigen Abständen,<br />
auf Aufforderung hin, den einweisenden Behörden<br />
über den Therapieverlauf Bericht erstatten. Die Behörden<br />
entscheiden aufgrund von Therapie- und<br />
Vollzugsverlaufsberichten, ob die Massnahme und<br />
damit die Therapie weitergeführt wird oder nicht.<br />
Mit anderen Worten: Der Eingewiesene muss sich<br />
die Rückkehr in die Freiheit erarbeiten. Über diese<br />
Fortschritte müssen die behandelnden Fachpersonen<br />
Rechenschaft ablegen. Dritte entscheiden, ob er die<br />
dazu erforderlichen Fortschritte gemacht hat.<br />
• Motivation als 1. Ziel:<br />
Von Aussenstehenden werde ich oft gefragt, ob eine<br />
angeordnete Therapie überhaupt durchführbar sei,<br />
wenn der betreffende Klient nicht oder kaum motiviert<br />
ist?<br />
Es gilt zu bedenken, dass wahrscheinlich in jeder<br />
therapeutischen Beziehung die Veränderungsbereitschaft<br />
Schwankungen im positiven und negativen<br />
Sinn unterworfen ist. Dahle (1997) betont, dass die<br />
Herstellung einer Behandlungsmotivation bei Delinquenten<br />
oft ein erstes Therapieziel ist und nicht<br />
die Voraussetzung einer Behandlung. Ein grundsätzlicher<br />
Mangel an Behandlungsbereitschaft besteht<br />
in der Regel nicht, sondern im Wege stehen ambivalente<br />
Haltungen, Wissensdefizite und unrealistische<br />
Therapieerwartungen.<br />
Verzerrte Bedürfnisse<br />
Von den 80 Eingewiesenen im Massnahmenzentrum<br />
haben 30 ein Delikt gegen die sexuelle Selbstbestimmung<br />
begangen: sexuelle Handlung mit Kind, Vergewaltigung,<br />
versuchte Vergewaltigung, sexuelle Nötigung,<br />
versuchte sexuelle Nötigung. Nur ein einziger<br />
Eingewiesener dieser Deliktgruppe hat die Diagnose<br />
«Pädophilie» nach ICD-<strong>10</strong>.<br />
Für die klinische Praxis hilfreiche Modelle über die<br />
Entstehungsbedingungen von Sexualdelinquenz referieren<br />
Ward, Polaschek u. Beech (2006). Sie beschreiben<br />
ein Bedürfnismodell, das den gesunden Menschen<br />
im Laufe seiner Sozialisation befähigt, bestimmte<br />
Kompetenzen für ein befriedigendes Leben zu erwerben:<br />
Dazu gehören prosoziale Wertvorstellungen, Ausbildung<br />
und Bildung, die Fähigkeit, zwischenmenschliche<br />
Beziehungen einzugehen, die das gegenseitige<br />
Wohl berücksichtigen, sowie schliesslich die Fähigkeit,<br />
für Kinder kompetente Elternteile und Bezugspersonen<br />
zu sein.<br />
Kriminelle Handlungen und dissoziale Einstellungen<br />
und Handlungen gegen die sexuelle Selbstbestimmung<br />
werden als Verzerrung solch allgemeingültiger zwischenmenschlicher<br />
Bedürfnisse beschrieben, die den<br />
Einzelnen daran hindern, diese sinnvoll zu befriedigen,<br />
d.h. ohne sich oder anderen willentlich zu schaden.<br />
Ein Sexualdelinquent ist nicht in der Lage, eine auf gegenseitiger<br />
Unterstützung beruhende intime Beziehung<br />
einzugehen. Internale Bedingungen, die ein Individuum<br />
13