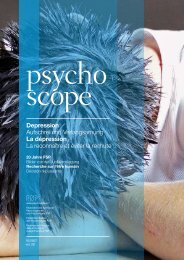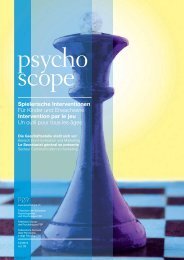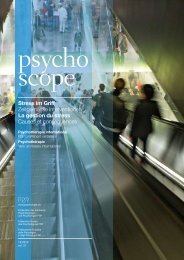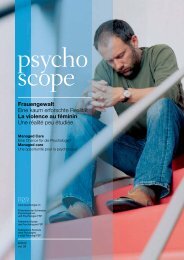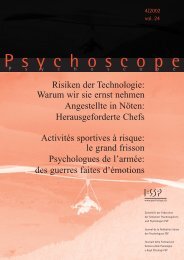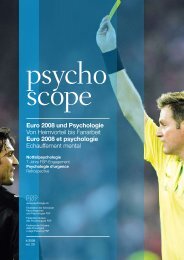PSC 10-08 - FSP
PSC 10-08 - FSP
PSC 10-08 - FSP
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Foto: Elena Martinez<br />
05<br />
Unter «Frauenkriminalität» wird die Summe der registrierten<br />
Straftaten von Personen weiblichen Geschlechts<br />
verstanden. Im Jahr 2004 waren gemäss Bundesamt für<br />
Statistik 5,5 Prozent aller Insassen in schweizerischen<br />
Strafvollzugsanstalten Frauen. Andrea Linder bestätigt<br />
in ihrer Untersuchung «<strong>10</strong>0 Jahre Frauenkriminalität»<br />
(Linder 2006), dass die Kriminalität der Frau hauptsächlich<br />
durch ihren niedrigen Anteil (ca. 20 Prozent)<br />
an der Gesamtkriminalität gekennzeichnet ist.<br />
Mehr junge Gewalttäterinnen<br />
Der Schwerpunkt der weiblichen Delinquenz liegt<br />
bei den Eigentums- und Vermögensdelikten. Das am<br />
häufigsten von Frauen begangene Delikt ist der einfache<br />
Diebstahl. Neben dem Diebstahl steht Betrug<br />
an zweiter Stelle. Frauen favorisieren Straftaten, deren<br />
Ausführung ohne Einsatz von Gewalt, einfach und<br />
risikoarm möglich ist. Der Frauenanteil an der Gewaltkriminalität<br />
ist hingegen gering.<br />
Andrea Linder zeigt zudem, dass seit den Siebzigerjahren<br />
ein flacher Anstieg der Frauenkriminalität zu verzeichnen<br />
ist. Erhöht habe sich dabei einzig die Straffälligkeit<br />
bei jungen Mädchen: Bei den unter 16-Jährigen<br />
und den bis unter 18-Jährigen lässt sich eine leichte Erhöhung<br />
bei den Delikten «einfache Körperverletzung»<br />
und «Raub» feststellen.<br />
Ob dieser Zuwachs an gewalttätigen jungen Mädchen<br />
ein zukünftig zu beachtendes Phänomen ist oder auf<br />
ein verändertes Anzeigeverhalten zurückzuführen ist,<br />
lässt sich erst in ein paar Jahren abschätzen. Die häufig<br />
vermerkte Veränderung der weiblichen Deliktstruktur,<br />
hin zu einer generell vermehrten Gewaltbereitschaft<br />
der Frau, kann durch das statistische Material nicht<br />
belegt werden. Von einer von einigen Autoren prognostizierten<br />
sukzessiven Angleichung der weiblichen und<br />
männlichen Kriminalität kann nicht die Rede sein.<br />
Unbefriedigende Erklärungsmodelle<br />
Kriminalität stellt ein komplexes Phänomen dar, welches<br />
sich nicht anhand einer einzigen Theorie erklären<br />
lässt. Unterschiedliche Delikte beruhen auf unterschiedlichen<br />
Motivationen. Die meisten der gängigen<br />
Theorien stützen sich nur auf Forschung zur Männerkriminalität.<br />
Untersuchungen über und mit Frauen<br />
sind infolge ihres geringen Anteils an der Kriminalität<br />
schwieriger zu gestalten. Die bisherigen Erklärungsmodelle<br />
können die weibliche Kriminalität und ihre Besonderheiten<br />
nicht befriedigend erklären. Die aktuell<br />
kontrovers diskutierten emanzipatorischen- und kriminalbiologischen<br />
Ansätze sind wenig hilfreich, gelten sie<br />
doch als einseitig oder veraltet. Ein brauchbares Erklärungsmodell<br />
für die Frauenkriminalität gibt es demnach<br />
nicht.<br />
Frauenstrafvollzug in der Schweiz<br />
Im Jahr 2006 gab es gemäss Bundesamt für Statistik in<br />
der Schweiz insgesamt 119 Institutionen des Freiheitsentzugs<br />
mit total 6724 Plätzen. Institutionen für Frauen<br />
sind die Anstalten Hindelbank im Kanton Bern mit<br />
<strong>10</strong>7 Plätzen sowie eine Abteilung für Frauen mit 54<br />
Plätzen im Prison de la Tuilière in Lonay.<br />
Aufgrund der beschriebenen Statistiken ist nachvollziehbar,<br />
dass die Konzepte für Vollzugsanstalten auf<br />
Männer ausgerichtet sind: Auch der Frauenstrafvollzug<br />
funktioniert in seinen Grundzügen weitgehend nach<br />
dem Konzept einer Männeranstalt. Eine offensichtliche<br />
Ausnahme davon bilden Mutter-Kind-Abteilungen, in<br />
welchen Frauen ihre Kinder bis zu deren drittem Lebensjahr<br />
bei sich behalten dürfen.<br />
Der Frauenstrafvollzug in der Schweiz muss deshalb<br />
nicht nur eine Balance finden zwischen den aus vier<br />
Landesteilen der Schweiz, vielen Nationen, und mit<br />
unterschiedlichsten Vollzugsaufträgen eingewiesenen<br />
Frauen, sondern auch seine Identität im Schatten der<br />
für Männer konzipierten Vollzugsanstalten. Dies ist<br />
eine äusserst komplexe Aufgabe.<br />
Wenn Frauen kriminell werden, dann stehlen oder betrügen<br />
sie hauptsächlich. Diese Delikte führen selten<br />
zu einem Freiheitsentzug. Frauen hinter Gittern haben<br />
dagegen getötet, mit Drogen gedealt oder Drogen transportiert.<br />
Ist man mit der Frauenkriminalität hinter Gittern<br />
konfrontiert, verschiebt sich der Blickwinkel deshalb<br />
auf Frauen mit schwerwiegenden Delikten.<br />
Im Jahr 2007 sassen in den Anstalten Hindelbank 27<br />
von 93 Insassinnen wegen Delikten gegen Leib und<br />
Leben ein. D.h. ca. 30 Prozent der Insassinnen sind