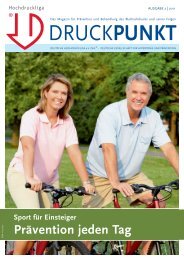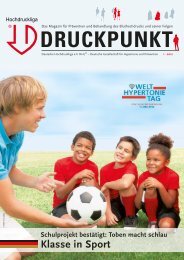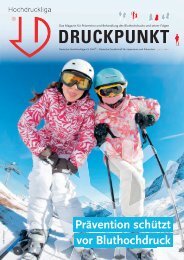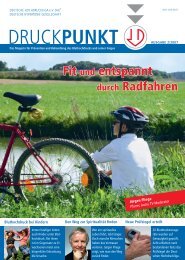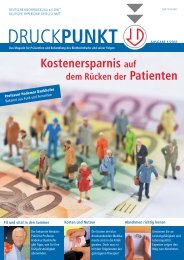punkt – druck - Deutsche Hochdruckliga
punkt – druck - Deutsche Hochdruckliga
punkt – druck - Deutsche Hochdruckliga
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
DRUCKPUNKT • Ausgabe 3<strong>–</strong>4/2010<br />
Körperliche Leistungsfähigkeit<br />
als entscheidender Schutzfaktor<br />
Neben den klassischen Risikofaktoren für Herz-<br />
Kreislauf-Erkrankungen ist die körperliche Leistungsfähigkeit<br />
der entscheidende gesundheitliche<br />
Faktor für den weiteren Verlauf der Erkrankung.<br />
Natürlich ist die konsequente Therapie klassischer<br />
Risikofaktoren wie Bluthoch<strong>druck</strong>, Fettstoffwechselstörungen<br />
und Übergewicht absolut notwendig,<br />
doch die Bedeutung der körperlichen Leistungsfähigkeit<br />
wird häufi g unterschätzt. Auch nach einem<br />
Herzinfarkt kann die Prognose bei guter Fitness<br />
exzellent sein. Umgekehrt haben Betroffene mit<br />
der geringsten Leistungsfähigkeit ein extrem hohes<br />
Risiko. Aus diesem Grund sprechen Fachgesellschaften<br />
wie die <strong>Deutsche</strong> Gesellschaft für Prävention<br />
und Rehabilitation von Herz-Kreislauf-Erkrankungen<br />
inzwischen auch von einem „körperlichen<br />
Training“ zur Therapie von Herzerkrankungen.<br />
Der richtige Einstieg<br />
Vor Beginn der sportlichen Aktivität steht die Bewertung<br />
des individuellen Herzrisikos, um das<br />
Risiko bei körperlicher Bewegung einzuschätzen<br />
und individuelle Trainingshinweise und Belastungsgrenzen<br />
ermitteln zu können. Dafür ist die<br />
Kooperation von Hausarzt oder Kardiologe mit<br />
dem Leiter der Herzgruppe notwendig. Dabei wird<br />
zunächst die Leistungsfähigkeit von Herz und<br />
Lunge bestimmt. Die Betroffenen werden später<br />
in der Herzgruppe der so genannten Trainingsgruppe<br />
zugeteilt, wenn sie einer Belastung von<br />
mehr als einem Watt pro Kilogramm Körpergewicht<br />
gewachsen sind. Ist die Leistungsfähigkeit<br />
geringer, werden sie zunächst die Übungsgruppe<br />
besuchen.<br />
Außerdem werden die Reaktionen von Blut<strong>druck</strong><br />
und Herzfrequenz unter Belastung gemessen und<br />
die individuelle Belastbarkeit sowie der Trainingspuls<br />
bestimmt. Es muss ausgeschlossen werden,<br />
dass die Probanden an einer Durchblutungsstörung<br />
des Herzens leiden (kardiale Ischämie) oder<br />
das Herz unter Belastung ins Stolpern gerät (belastungsinduzierte<br />
Herzrhythmusstörung). Nach<br />
Abschluss dieser Voruntersuchungen erhält der<br />
Patient von seinem Hausarzt in der Regel ein Rezept<br />
für die Teilnahme an einer Herzgruppe. Meist<br />
ist das Rezept über 90 Übungseinheiten in 24 Monaten<br />
ausgestellt, die übliche Dauer, die von den<br />
gesetzlichen Krankenkassen übernommen wird.<br />
Vor Beginn des Trainings müssen die Betroffenen<br />
das Rezept zur Genehmigung ihrer Krankenkasse<br />
vorlegen.<br />
BEWEGUNG<br />
Körperliche Aktivität nach Schlaganfall<br />
Ein Schlaganfall ist meist die Folge der Grunderkrankung Arteriosklerose.<br />
Risikofaktoren und individuelles Risiko sind also für einen Schlaganfall<br />
ganz ähnlich wie bei einem Herzinfarkt. Allerdings scheint Bluthoch<strong>druck</strong><br />
für einen Schlaganfall eine größere Rolle zu spielen. Trotzdem können die<br />
Bewegungsempfehlungen aus dem Herzsport nicht einfach übernommen<br />
werden. In erster Linie liegt das an den motorischen Einschränkungen, die<br />
häufi g nach einem Schlaganfall weiterhin bestehen. Während der manchmal<br />
langwierigen Rehabilitation stehen für die Betroffenen Physio- und<br />
Ergotherapie im Vordergrund. Die Bewegungstherapie ist in der Regel viel<br />
individueller gestaltet und entzieht sich damit weitestgehend allgemeinen<br />
Empfehlungen.<br />
Trainingsempfehlungen<br />
Während früher ausschließlich Ausdauerbelastungen<br />
empfohlen wurden, sind inzwischen auch<br />
Muskelaufbautraining oder Kraftausdauertraining<br />
akzeptiert. Auch die Verbesserung von koordinativen<br />
Fähigkeiten und Beweglichkeit sollte<br />
man nicht vernachlässigen. Sinnvolle Sportarten<br />
sind Gehen, Laufen (Jogging), Schwimmen, Radfahren<br />
und Ausdauertraining an Geräten wie Ruderergometer.<br />
Generell ist der Einstieg über eine<br />
ambulante Herzgruppe empfehlenswert, um die<br />
eigene Belastbarkeit kennen zu lernen und um<br />
das Training zu steuern. Es gibt auch Gruppen,<br />
die sich schwer<strong>punkt</strong>mäßig mit Kraftaufbau befassen.<br />
Üblicherweise erfolgt die Einteilung des Trainingsaufbaus<br />
in drei Phasen:<br />
1. Anpassungsphase<br />
Die Grundlagen für den Bewegungsapparat werden<br />
gelegt und Muskeln und Bänder auf die noch<br />
ungewohnte Bewegung vorbereitet. Durch Inaktivität<br />
eingeschränkte Beweglichkeit und Koordination<br />
werden verbessert.<br />
2. Aufbauphase<br />
Dauer und Häufi gkeit des Trainings werden allmählich<br />
gesteigert. Später wird bei guter Toleranz<br />
und Stabilisierung des Herzens das Training intensiviert.<br />
3. Stabilisationsphase<br />
Die sportliche Aktivität wird ganz selbstverständlich<br />
in den üblichen Tagesablauf integriert und die<br />
körperliche Leistungsfähigkeit weiter verbessert.<br />
37