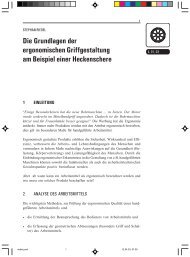Die Kunst des Alterns
Die Kunst des Alterns
Die Kunst des Alterns
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
10 zu sehen – im Triumvirat renommierte<br />
Akteure vertreten. Ein nicht unerheblicher<br />
wissenschaftlicher Input wurde<br />
auch vom Institut für Arbeitsphysiologie<br />
in Dortmund geleistet, einem Forschungsinstitut,<br />
das in der Tradition<br />
<strong>des</strong> Max-Planck-Instituts für Arbeitsphysiologie<br />
steht.<br />
2.6 Lehrbücher der Ergonomie/<br />
Arbeitswissenschaft und die<br />
„weißblaue“ Schriftenreihe –<br />
Undenkbar ohne arbeitsphysiologisches<br />
Gedankengut<br />
Arbeitsphysiologisches Grundlagenwissen,<br />
d. h. Wissen über Bau und<br />
Funktion <strong>des</strong> menschlichen Körpers<br />
und seiner Organsysteme – schon vor<br />
einem Viertel-Jahrhundert kompakt von<br />
Rohmert & Rutenfranz (1983) dargestellt<br />
– ist im Laufe der Zeit in eine stattliche<br />
Reihe von Lehrbüchern der Ergonomie<br />
bzw. Arbeitswissenschaft eingeflossen<br />
(vgl. Bild 11). Hierzu sei u. a.<br />
auf die „Physiologische Arbeitsgestaltung“<br />
von Grandjean (1979) als<br />
einem wichtigen „Leitfaden der Ergonomie“,<br />
auf Schmidtke’s „Ergonomie“<br />
(Schmidtke 1993), das von Hettinger<br />
herausgegebene „Kompendium der<br />
Arbeitswissenschaft“ (Hettinger &<br />
Wobbe 1993) oder auf die „Grundzüge<br />
der Ergonomie“ (Laurig 1992) verwiesen.<br />
Aber auch das seitenmäßig<br />
vielleicht umfangreichste Werk, das<br />
„Handbuch Arbeitswissenschaft“ von<br />
Luczak & Volpert (1996) oder das für<br />
die Lehre gedachte „Arbeitswissenschaft“<br />
(Luczak 1993) tragen den Stempel<br />
der „Arbeitsphysiologie“. Gleiches<br />
gilt auch für Bullingers „Ergonomie“ als<br />
Grundlage zur „Produkt- und<br />
Arbeitsplatzgestaltung“ (Bullinger<br />
1994). Demnach ist bei konstruktiven<br />
Maßnahmen stets am Menschen Maß<br />
zu nehmen und bei handgeführten Arbeitsmitteln<br />
die Gleichung zu erfüllen,<br />
„menschengerecht = handgerecht“.<br />
Dass Arbeit sich heutzutage oft auch<br />
im <strong>Die</strong>nstleistungsbereich abspielt,<br />
wurde mit einem von Landau & Stübler<br />
(1992) herausgegebenen Werk Rechnung<br />
getragen. Mit einem umfangreichen<br />
„Lexikon der Arbeitsgestaltung“,<br />
in dem auch arbeitsphysiologische und<br />
psychologische Eigengesetzlichkeiten<br />
<strong>des</strong> Menschen „nachgeschlagen“ werden<br />
können, versucht Landau (2007)<br />
Bild 11: Lehrbücher der Ergonomie / Arbeitswissenschaft<br />
Figure 11: Textbooks of Ergonomics/Work Science (in German)<br />
Illustration 11: Manuels relatifs à la science du travail et à l’ergonomie<br />
die „Bringschuld“ der Arbeitswissenschaft<br />
gegenüber der Industrie und der<br />
realen Arbeitswelt einzulösen.<br />
Schließlich sei auch auf die „weißblaue“<br />
Schriftenreihe <strong>des</strong> Bayerischen Staatsministeriums<br />
für Arbeit und Sozialordnung<br />
(vgl. Bild 12) hingewiesen, die<br />
Auflagehöhen erreichte, von denen<br />
man sonst in Wissenschaftskreisen nur<br />
träumen kann. Bezeichnenderweise<br />
wurde diese Reihe mit einer Broschüre<br />
eines Arbeitsphysiologen und Ergonomen<br />
eröffnet. Grandjean und sein Mitarbeiter<br />
(Grandjean & Hünting 1983)<br />
stellten die Frage „Sitzen Sie richtig?“.<br />
Obwohl „Sitzhaltung und Sitzgestaltung<br />
am Arbeitsplatz“ das Kernthema<br />
waren, blieben damals Fragen<br />
offen. U. a. gab Krueger (1995) darauf<br />
eine Antwort und setzte mit dem Titel<br />
„Richtig Sitzen“ auch ein deutliches<br />
Ausrufezeichen. Hauptthema <strong>des</strong> Instituts<br />
für Hygiene und Arbeitsphysiologie<br />
der ETH-Zürich war aber über<br />
Jahrzehnte das Sehen am Arbeitsplatz<br />
(vgl. z. B. Krueger 1968, 1979, 1993), was<br />
auch durch die Schrift „Arbeiten mit<br />
dem Bildschirm – aber richtig!“ (Krueger<br />
1989) dokumentiert wurde. Dass<br />
sich mit Wenzel & Piekarski (1980)<br />
wiederum Mediziner und Physiologen<br />
mit „Klima und Arbeit“ auseinandersetzten,<br />
sollte deutlich machen, dass<br />
die Arbeitsphysiologie einen kostbaren<br />
und unverzichtbaren Wissensschatz<br />
für praktische Fragen der Umwelt-Ergonomie<br />
birgt. In diesem Sinne<br />
erwähnenswert sind natürlich auch die<br />
Broschüren „Lärmschutz im Betrieb“<br />
(Schmidtke et al. 1981) und Hettinger’s<br />
„Schwere Lasten – leicht gehoben“<br />
(Hettinger & Hahn 1991) oder die Broschüre<br />
„Farbe am Arbeitsplatz“ von<br />
Frieling (1992). Müller-Limmroth hatte<br />
sich als Arbeitsphysiologe vertieft mit<br />
dem Thema „Arbeit und Stress“ befasst<br />
und entsprechend zur Schriftenreihe<br />
beigetragen (vgl. Müller-<br />
Limmroth & Schug 1990), so wie auch<br />
„Schichtarbeit und Nachtarbeit“ ein<br />
Thema war, das nur mit arbeitsphysiologischer<br />
Fachkompetenz, in<br />
diesem Fall von Rutenfranz und einem<br />
seiner damaligen Mitarbeiter (Rutenfranz<br />
& Knauth 1989) umfassend<br />
bearbeitet werden konnte. Dass die arbeitende<br />
Bevölkerung schließlich<br />
immer älter wird, und dass die Arbeitswissenschaft<br />
sich damit beschäftigen<br />
muss, wurde schon 1986 von einem<br />
Autorenkollektiv (N.N. 1986) mit Fak-<br />
(61) 2007/3 Z. ARB. WISS. Zur Entwicklung der Arbeitsphysiologie und Ergonomie im deutschsprachigen Raum 143<br />
Strasser.pmd 143<br />
31.08.2007, 13:19