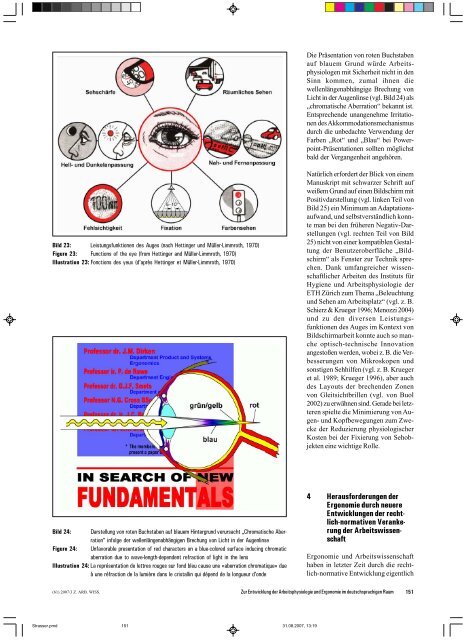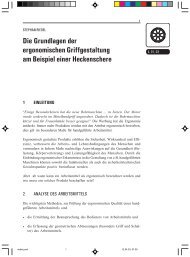Die Kunst des Alterns
Die Kunst des Alterns
Die Kunst des Alterns
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Bild 23: Leistungsfunktionen <strong>des</strong> Auges (nach Hettinger und Müller-Limmroth, 1970)<br />
Figure 23: Functions of the eye (from Hettinger and Müller-Limmroth, 1970)<br />
Illustration 23: Fonctions <strong>des</strong> yeux (d’après Hettinger et Müller-Limmroth, 1970)<br />
Bild 24: Darstellung von roten Buchstaben auf blauem Hintergrund verursacht „Chromatische Aberration“<br />
infolge der wellenlängenabhängigen Brechung von Licht in der Augenlinse<br />
Figure 24: Unfavorable presentation of red characters on a blue-colored surface inducing chromatic<br />
aberration due to wave-length-dependent refraction of light in the lens<br />
Illustration 24: La représentation de lettres rouges sur fond bleu cause une «aberration chromatique» due<br />
à une réfraction de la lumière dans le cristallin qui dépend de la longueur d’onde<br />
<strong>Die</strong> Präsentation von roten Buchstaben<br />
auf blauem Grund würde Arbeitsphysiologen<br />
mit Sicherheit nicht in den<br />
Sinn kommen, zumal ihnen die<br />
wellenlängenabhängige Brechung von<br />
Licht in der Augenlinse (vgl. Bild 24) als<br />
„chromatische Aberration“ bekannt ist.<br />
Entsprechende unangenehme Irritationen<br />
<strong>des</strong> Akkommodationsmechanismus<br />
durch die unbedachte Verwendung der<br />
Farben „Rot“ und „Blau“ bei Powerpoint-Präsentationen<br />
sollten möglichst<br />
bald der Vergangenheit angehören.<br />
Natürlich erfordert der Blick von einem<br />
Manuskript mit schwarzer Schrift auf<br />
weißem Grund auf einen Bildschirm mit<br />
Positivdarstellung (vgl. linken Teil von<br />
Bild 25) ein Minimum an Adaptationsaufwand,<br />
und selbstverständlich konnte<br />
man bei den früheren Negativ-Darstellungen<br />
(vgl. rechten Teil von Bild<br />
25) nicht von einer kompatiblen Gestaltung<br />
der Benutzeroberfläche „Bildschirm“<br />
als Fenster zur Technik sprechen.<br />
Dank umfangreicher wissenschaftlicher<br />
Arbeiten <strong>des</strong> Instituts für<br />
Hygiene und Arbeitsphysiologie der<br />
ETH Zürich zum Thema „Beleuchtung<br />
und Sehen am Arbeitsplatz“ (vgl. z. B.<br />
Schierz & Krueger 1996; Menozzi 2004)<br />
und zu den diversen Leistungsfunktionen<br />
<strong>des</strong> Auges im Kontext von<br />
Bildschirmarbeit konnte auch so manche<br />
optisch-technische Innovation<br />
angestoßen werden, wobei z. B. die Verbesserungen<br />
von Mikroskopen und<br />
sonstigen Sehhilfen (vgl. z. B. Krueger<br />
et al. 1989; Krueger 1996), aber auch<br />
<strong>des</strong> Layouts der brechenden Zonen<br />
von Gleitsichtbrillen (vgl. von Buol<br />
2002) zu erwähnen sind. Gerade bei letzteren<br />
spielte die Minimierung von Augen-<br />
und Kopfbewegungen zum Zwecke<br />
der Reduzierung physiologischer<br />
Kosten bei der Fixierung von Sehobjekten<br />
eine wichtige Rolle.<br />
4 Herausforderungen der<br />
Ergonomie durch neuere<br />
Entwicklungen der rechtlich-normativenVerankerung<br />
der Arbeitswissenschaft<br />
Ergonomie und Arbeitswissenschaft<br />
haben in letzter Zeit durch die rechtlich-normative<br />
Entwicklung eigentlich<br />
(61) 2007/3 Z. ARB. WISS. Zur Entwicklung der Arbeitsphysiologie und Ergonomie im deutschsprachigen Raum 151<br />
Strasser.pmd 151<br />
31.08.2007, 13:19