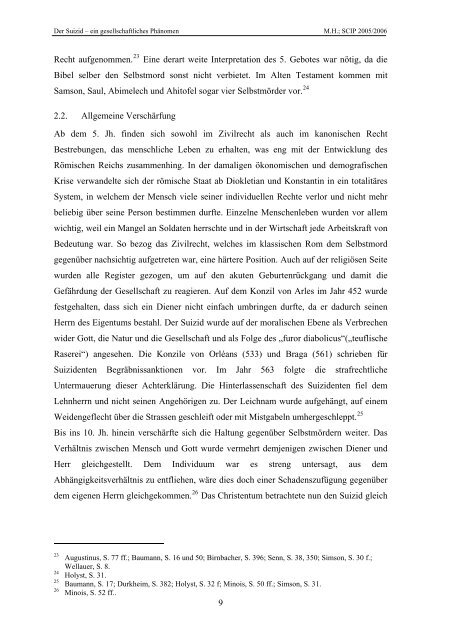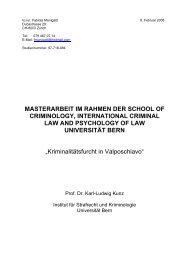Der Suizid – ein gesellschaftliches Phänomen - SCIP
Der Suizid – ein gesellschaftliches Phänomen - SCIP
Der Suizid – ein gesellschaftliches Phänomen - SCIP
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Der</strong> <strong>Suizid</strong> <strong>–</strong> <strong>ein</strong> <strong>gesellschaftliches</strong> <strong>Phänomen</strong> M.H.; <strong>SCIP</strong> 2005/2006<br />
Recht aufgenommen. 23 Eine derart weite Interpretation des 5. Gebotes war nötig, da die<br />
Bibel selber den Selbstmord sonst nicht verbietet. Im Alten Testament kommen mit<br />
Samson, Saul, Abimelech und Ahitofel sogar vier Selbstmörder vor. 24<br />
2.2. Allgem<strong>ein</strong>e Verschärfung<br />
Ab dem 5. Jh. finden sich sowohl im Zivilrecht als auch im kanonischen Recht<br />
Bestrebungen, das menschliche Leben zu erhalten, was eng mit der Entwicklung des<br />
Römischen Reichs zusammenhing. In der damaligen ökonomischen und demografischen<br />
Krise verwandelte sich der römische Staat ab Diokletian und Konstantin in <strong>ein</strong> totalitäres<br />
System, in welchem der Mensch viele s<strong>ein</strong>er individuellen Rechte verlor und nicht mehr<br />
beliebig über s<strong>ein</strong>e Person bestimmen durfte. Einzelne Menschenleben wurden vor allem<br />
wichtig, weil <strong>ein</strong> Mangel an Soldaten herrschte und in der Wirtschaft jede Arbeitskraft von<br />
Bedeutung war. So bezog das Zivilrecht, welches im klassischen Rom dem Selbstmord<br />
gegenüber nachsichtig aufgetreten war, <strong>ein</strong>e härtere Position. Auch auf der religiösen Seite<br />
wurden alle Register gezogen, um auf den akuten Geburtenrückgang und damit die<br />
Gefährdung der Gesellschaft zu reagieren. Auf dem Konzil von Arles im Jahr 452 wurde<br />
festgehalten, dass sich <strong>ein</strong> Diener nicht <strong>ein</strong>fach umbringen durfte, da er dadurch s<strong>ein</strong>en<br />
Herrn des Eigentums bestahl. <strong>Der</strong> <strong>Suizid</strong> wurde auf der moralischen Ebene als Verbrechen<br />
wider Gott, die Natur und die Gesellschaft und als Folge des „furor diabolicus“(„teuflische<br />
Raserei“) angesehen. Die Konzile von Orléans (533) und Braga (561) schrieben für<br />
<strong>Suizid</strong>enten Begräbnissanktionen vor. Im Jahr 563 folgte die strafrechtliche<br />
Untermauerung dieser Achterklärung. Die Hinterlassenschaft des <strong>Suizid</strong>enten fiel dem<br />
Lehnherrn und nicht s<strong>ein</strong>en Angehörigen zu. <strong>Der</strong> Leichnam wurde aufgehängt, auf <strong>ein</strong>em<br />
Weidengeflecht über die Strassen geschleift oder mit Mistgabeln umhergeschleppt. 25<br />
Bis ins 10. Jh. hin<strong>ein</strong> verschärfte sich die Haltung gegenüber Selbstmördern weiter. Das<br />
Verhältnis zwischen Mensch und Gott wurde vermehrt demjenigen zwischen Diener und<br />
Herr gleichgestellt. Dem Individuum war es streng untersagt, aus dem<br />
Abhängigkeitsverhältnis zu entfliehen, wäre dies doch <strong>ein</strong>er Schadenszufügung gegenüber<br />
dem eigenen Herrn gleichgekommen. 26 Das Christentum betrachtete nun den <strong>Suizid</strong> gleich<br />
23<br />
Augustinus, S. 77 ff.; Baumann, S. 16 und 50; Birnbacher, S. 396; Senn, S. 38, 350; Simson, S. 30 f.;<br />
Wellauer, S. 8.<br />
24<br />
Holyst, S. 31.<br />
25<br />
Baumann, S. 17; Durkheim, S. 382; Holyst, S. 32 f; Minois, S. 50 ff.; Simson, S. 31.<br />
26<br />
Minois, S. 52 ff..<br />
9