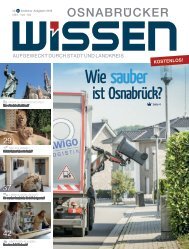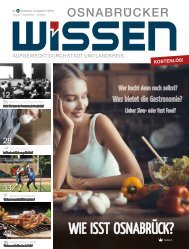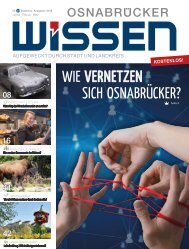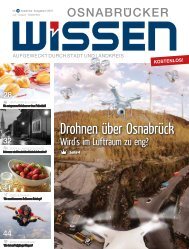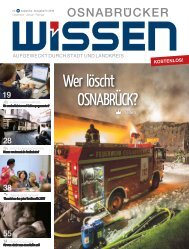Nr. 23 (IV-2018) - Osnabrücker Wissen
Nr. 23 (IV-2018) - Osnabrücker Wissen Wir beantworten Fragen rund um die Osnabrücker Region. Alle drei Monate als Printausgabe. Kostenlos! Und online unter www.osnabruecker-wissen.de
Nr. 23 (IV-2018) - Osnabrücker Wissen
Wir beantworten Fragen rund um die Osnabrücker Region. Alle drei Monate als Printausgabe. Kostenlos! Und online unter www.osnabruecker-wissen.de
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
KUNST & KULTUR<br />
KUNST & KULTUR<br />
Kunst oder Propaganda?<br />
Der „Staatsschauspieler“<br />
Mathias Wieman<br />
Er war einer der großen Charakterdarsteller des 20. Jahrhunderts und begeisterte sein Publikum<br />
auf Theaterbühnen, Kinoleinwänden und Schallplatten. Aber er rührte auch Joseph Goebbels zu<br />
Tränen und trat in nationalsozialistischen Propagandafilmen auf.<br />
Mathias Wieman in der<br />
Storm-Verfilmung „Der Schimmelreiter“<br />
Mathias Wieman wurde am <strong>23</strong>. Juni 1902 in Osnabrück geboren,<br />
wuchs aber in Berlin auf. Nach dem Abitur begann er Philosophie<br />
und Kunstgeschichte zu studieren, dann wechselte er für<br />
einige Monate zur Schauspielschule des Deutschen Theaters, um<br />
schließlich bei einer schleswig-holsteinischen Wanderbühne anzuheuern.<br />
Wiemans Entscheidung für das Theater führte zu „heftigen Auseinandersetzungen<br />
daheim“, doch er hatte die richtige Wahl<br />
getroffen. Mitte der 1920er Jahre holte ihn Max Reinhardt ans<br />
Deutsche Theater. Wieman war fortan in zahlreichen Klassikern,<br />
vielen zeitgenössischen Stücken und später immer wieder in Goethes<br />
„Faust zu sehen“. Schnell wurde sein außergewöhnliches Talent<br />
auch für den noch jungen Film entdeckt.<br />
Hitlers angehende Lieblingsregisseurin Leni Riefenstahl holte ihn<br />
für ihr Debüt „Das Blaue Licht“ (1932) vor die Kamera, dann bekam<br />
er die Hauptrolle in der ideologisch verbogenen Storm-Verfilmung<br />
„Der Schimmelreiter“ (1933) und als er in „Viktoria“ um<br />
Luise Ullrich warb, schrieb Joseph Goebbels in sein Tagebuch:<br />
„Ergreifend. Wieman und Ulrich. Zu Tränen rührend. Das wird,<br />
hoffe ich, ein ganz großer Wurf.“ Auch der Streifen „Patrioten“, in<br />
dem der zukünftige Staatsschauspieler an der Seite von Goebbels´<br />
Geliebter Lída Baarová zu sehen war (1937), fand den Beifall des<br />
Propagandaministers.<br />
Doch die Gunst des Mächtigen war nicht von langer Dauer.<br />
Goebbels störte sich insbesondere an Wiemans Offiziersrollen,<br />
die er als wenig martialisch und „zuweilen unausstehlich“ empfand.<br />
Nach 1945 gab der Schauspieler zu Protokoll, seinerseits<br />
auf Distanz zu einem System gegangen zu sein, dessen verbrecherischen<br />
Charakter er immer deutlicher erkannt habe. Trotzdem<br />
bekam Mathias Wieman, dem anfällige Figuren tatsächlich<br />
Pferdebild © : "Filmwelt" - Aufnahme Fritsch-Produktion-Europa / Angst: Illustrierte Film-Bühne <strong>Nr</strong>. 2560 / Unternehmen Michael: www.imdb.com / Hintergrund © abbiesartshop, fotolia.de<br />
mehr lagen als pathetische Helden, noch<br />
eine fatale Rolle in einem NS-Propagandawerk.<br />
„Ich klage an“ (1941) warb unter<br />
dem Deckmantel eines Ehedramas für die<br />
nationalsozialistische „Vernichtung lebensunwerten<br />
Lebens“. Einer „der infamsten<br />
Propagandafilme des Dritten Reiches“,<br />
urteilte der Filmhistoriker Hans Schmid.<br />
In den letzten Kriegsjahren spielte Wieman<br />
wieder vermehrt Theater, präsentierte<br />
am Sonntag im Rundfunk „Das Schatzkästlein“<br />
deutscher Dichtung und begann<br />
mit der Aufnahme zahlreicher Schallplatten.<br />
Er las Werke von Goethe, Hölderlin<br />
oder Mörike, Märchen der Gebrüder<br />
Grimm und aus Tausendundeiner Nacht,<br />
aber auch Homers „Odyssee“ – Literatur,<br />
die er für einen humanen Gegenentwurf<br />
zur Nazi-Diktatur hielt, während ihm Kritiker<br />
vorwarfen, dem Dritten Reich noch<br />
einen kulturellen Anstrich zu geben.<br />
In den 1960er Jahren war seine Stimme<br />
so populär, dass er eine späte Karriere als<br />
Werbesprecher startete. „Wenn einem so<br />
viel Gutes widerfährt …“, raunte es durch<br />
Deutschlands Wohnzimmer und auch die<br />
Film- und Theaterengagements wurden<br />
ab 1950 wieder häufiger. Mathias Wie-<br />
DAS GESPRÄCH<br />
Der Wieman kommt herein und sagt: „Eggebrecht, können<br />
Sie mir helfen? Ich bin von den Engländern als Nazischauspieler<br />
verboten und darf nichts mehr machen.“ Ich<br />
habe ihm einen Vorschlag gemacht: „Wieman, wir setzen<br />
uns jetzt vor ein Mikrofon, und ich werde sie hart und böse<br />
fragen, wie kamen Sie dazu, Gedichtabende für die ´Hitler<br />
Jugend´ zu veranstalten, (...) Und so habe ich ihn befragt<br />
und er hat mit schöner Offenheit alles zugegeben. Und<br />
dann habe ich den Engländern das Band vorgespielt, als<br />
ein Musterfall sinnvoller Entnazifizierung. Er durfte wieder<br />
arbeiten und ist dann der große Sprecher und Schauspieler<br />
gewesen.“<br />
Das Gespräch mit dem Journalisten und Schriftseller Axel<br />
Eggebrecht wurde am 5. September 1945 gesendet und<br />
ist unter www.hamburg.de als mp3-Datei verfügbar.<br />
man, über dessen Rolle im Dritten Reich<br />
immer wieder diskutiert wurde, spielte in<br />
Berlin, Hamburg, Stuttgart, Zürich oder<br />
Wien und stand mit Stars wie O.W. Fischer,<br />
Brigitte Horney, Romy Schneider,<br />
Liselotte Pulver, Maximilian Schell, Horst<br />
Buchholz und Gert Fröbe vor der Kamera.<br />
Auch internationale Produktionen setzten<br />
auf den Charakterdarsteller – so etwa die<br />
deutsch-italienische Stefan-Zweig-Verfilmung<br />
„Angst“ (1954), in der Wieman unter<br />
der Regie von Roberto Rossellini neben<br />
Ingrid Bergman zu sehen war.<br />
Im November 1969 stand er als Pastor<br />
Manders in Henrik Ibsens „Gespenster“<br />
auf der Bühne des Hamburger Thalia<br />
Theaters. Es sollte seine letzte Rolle werden.<br />
Mathias Wieman starb am 3. Dezember<br />
1969 in Zürich an den Folgen einer<br />
schweren Operation. Er wurde auf dem<br />
Johannisfriedhof in Osnabrück beigesetzt.<br />
| Thorsten Stegemann<br />
Link-Tipp: Ausführliche Informationen<br />
zu Leben und Werk sowie zahlreiche<br />
Daten und Bilder gibt es auf der Seite:<br />
www.dieterleitner.de<br />
WISSEN KOMPAKT<br />
VORBEHALTSFILME<br />
Unter diesem Begriff versammelt<br />
die Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftungrund<br />
40 Propagandafilme des<br />
Dritten Reiches, „die eine<br />
deutlich rassistische, antisemitische,<br />
volksverhetzende und/<br />
oder kriegsverherrlichende<br />
Botschaft beinhalten“ und<br />
nicht für den Verleih freigegeben<br />
werden. In diese Kategorie<br />
fallen – neben „Ich klage<br />
an“ – drei weitere Wieman-Filme:<br />
„Togger“, „Unternehmen<br />
Michael“ (beide 1937) und<br />
„Kadetten“ (1941).<br />
48<br />
Filmprogramm zu Roberto Rossellinis „Angst“<br />
mit Ingrid Bergman und Mathias Wieman<br />
49