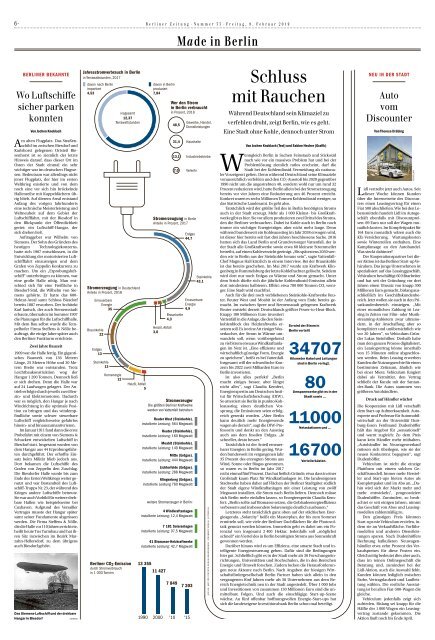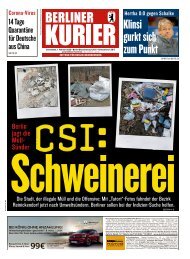Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
6* <strong>Berliner</strong> <strong>Zeitung</strong> · N ummer 33 · F reitag, 8. Februar 2019<br />
·························································································································································································································································································<br />
Made in Berlin<br />
BERLINER BEKANNTE<br />
Wo Luftschiffe<br />
sicher parken<br />
konnten<br />
VonJochen Knoblach<br />
Amalten Flugplatz. Das Straßenschild<br />
im zwischen Biesdorfund<br />
Karlshorst gelegenen Ortsteil Biesenhorst<br />
ist so ziemlich der letzte<br />
Hinweis darauf, dass dieser Ort im<br />
Osten der Stadt einmal ein sehr<br />
wichtiger war im deutschen Flugwesen.<br />
Bedeutsam war allerdings nicht<br />
jener Flugplatz, der hier im ersten<br />
Weltkrieg existierte und von dem<br />
noch eine vor sich hin bröckelnde<br />
Hallenreihe mit Kuppeldächern übrig<br />
blieb. Auf diesem Areal entstand<br />
Anfang des vorigen Jahrhunderts<br />
eine technische Meisterleistung und<br />
Weltneuheit auf dem Gebiet der<br />
Luftschifffahrt, mit der Biesdorf in<br />
den Blickpunkt der Öffentlichkeit<br />
geriet: ein Luftschiff-Hangar, der<br />
sich drehen ließ.<br />
Auftraggeber war Wilhelm von<br />
Siemens.Der Sohn des Gründers des<br />
heutigen Technologiekonzerns,<br />
hatte sich 1907 entschlossen, in die<br />
Entwicklung der motorisierten Luftschifffahrt<br />
einzusteigen und dem<br />
Grafen von Zeppelin Konkurrenz zu<br />
machen. Um ein „Erprobungsluftschiff“<br />
unterbringen zu können, war<br />
eine große Halle nötig. Man entschied<br />
sich für eine Freifläche in<br />
Biesdorf-Süd, die Wilhelm von Siemens<br />
gehörte. Er hatte das 600-<br />
Hektar-Areal samt Schloss Biesdorf<br />
bereits 1887 erworben. DerArchitekt<br />
Karl Janisch, der auch Siemensstadt<br />
erbaute,übernahm im Sommer 1907<br />
die Planungen für die Luftschiffhalle.<br />
Mit dem Bau selbst wurde die Tempelhofer<br />
Firma Steffens &Nölle beauftragt,<br />
die einige Jahrespäter auch<br />
den <strong>Berliner</strong> Funkturmerrichtete.<br />
Zwei JahreBauzeit<br />
1909 war die Halle fertig. Eingigantisches<br />
Bauwerk von 136 Metern<br />
Länge, 25Metern Höhe und 30 Metern<br />
Breite war entstanden. Trotz<br />
Leichtbaukonstruktion wog der<br />
Hangar 1200 Tonnen. Dennoch ließ<br />
er sich drehen. Denn die Halle war<br />
auf 24 Laufwagen gelagert. Der Antrieb<br />
erfolgte durch jeweils zwei Benzin-<br />
und Elektromotoren. Dadurch<br />
war es möglich, den Hangar je nach<br />
Windrichtung in die optimale Position<br />
zu bringen und das windempfindliche<br />
sowie schwer steuerbare<br />
Luftschiff vergleichsweise gefahrlos<br />
hinein- und hinauszumanövrieren.<br />
Im Januar 1911 fand dann die erste<br />
Probefahrtmit einem vonSiemens &<br />
Schuckert entwickelten Luftschiff in<br />
Biesdorfstatt. Insgesamt wurden von<br />
dem Hangar aus 44 Erprobungsfahrten<br />
durchgeführt. Der erhoffte Einsatz<br />
beim Militär blieb jedoch aus.<br />
Dort bekamen die Luftschiffe des<br />
Grafen von Zeppelin den Zuschlag.<br />
Die Biesdorfer Halle wurde bis zum<br />
Ende des Ersten Weltkriegs weiter genutzt<br />
und war Bestandteil des Luftschiff-Trupps<br />
Nr.23, der während des<br />
Krieges andere Luftschiffe betreute.<br />
Siewar auch Vorbild für weiteredrehbare<br />
Hallen wie beispielsweise bei<br />
Cuxhaven. Aufgrund des Versailler<br />
Vertrages musste der Hangar später<br />
samt seiner Fundamente abgerissen<br />
werden. Die Firma Steffens &Nölle,<br />
die die Halle vor110 Jahren errichtete,<br />
heißt heute Tns Turmbau und hat ihren<br />
Sitz inzwischen im Bezirk Marzahn-Hellersdorf,<br />
zu dem übrigens<br />
auch Biesdorfgehört.<br />
Das Siemens-Luftschiff und der drehbare<br />
Hangar in Biesdorf<br />
SIEMENS<br />
Jahresstromverbrauch in Berlin<br />
in Terrawattstunden, 2017<br />
davon nach Berlin<br />
importiert<br />
4,53<br />
Erneuerbare<br />
Energie<br />
35<br />
Braunkohle<br />
22<br />
Erdgas<br />
13<br />
Steinkohle<br />
13<br />
Kernenergie<br />
12<br />
insgesamt<br />
12,37<br />
Terrawattstunden<br />
Stromerzeugung in Deutschland<br />
Anteile in Prozent, 2018<br />
<strong>Berliner</strong> CO 2 -Emission<br />
durch Stromverbrauch<br />
in 1000 Tonnen<br />
Heizöl, Abfall<br />
5<br />
13 355<br />
davon inBerlin<br />
produziert<br />
7,84<br />
Wer den Strom<br />
in Berlin verbraucht<br />
in Prozent, 2016<br />
Stromerzeugung in Berlin<br />
Anteile in Prozent, 2017<br />
Heizöl, Abfall<br />
3,0<br />
Stromerzeuger<br />
Die größten <strong>Berliner</strong> Kraftwerke<br />
werden vonVattenfall betrieben<br />
weitere Stromerzeuger in Berlin:<br />
11 427<br />
48,5<br />
31,4<br />
13,1<br />
7,0<br />
Braunkohle<br />
4,3<br />
7849 7203<br />
1990 2000 '10 '15<br />
Gewerbe, Handel,<br />
Dienstleistungen<br />
Haushalte<br />
Industriebetriebe<br />
Verkehr<br />
Erdgas<br />
44,7<br />
Erneuerbare<br />
Energie<br />
4,9<br />
Reuter West (Steinkohle),<br />
installierte Leistung: 564 Megawatt<br />
Reuter (Steinkohle),<br />
installierte Leistung: 160 Megawatt<br />
Moabit (Steinkohle),<br />
installierte Leistung: 140 Megawatt<br />
Mitte (Erdgas),<br />
installierte Leistung: 444 Megawatt<br />
Lichterfelde (Erdgas),<br />
installierte Leistung: 288 Megawatt<br />
Klingenberg (Erdgas),<br />
installierte Leistung 760 Megawatt<br />
4Windkraftanlagen<br />
installierte Leistung: 12,4 Megawatt<br />
7181 Solaranlagen<br />
installierte Leistung: 97,5 Megawatt<br />
41 Biomasse-Heizkraftwerke<br />
installierte Leistung: 42,7 Megawatt<br />
Steinkohle<br />
43,1<br />
QUELLE: AMT FÜR STATISTIK BERLIN/BRANDENBURG, STROMNETZ BERLIN, VATTENFALL<br />
Schluss<br />
mit Rauchen<br />
Während Deutschland sein Klimaziel zu<br />
verfehlen droht, zeigt Berlin, wie es geht.<br />
Eine Stadt ohne Kohle, dennoch unter Strom<br />
VonJochen Knoblach (Text) und Sabine Hecher (Grafik)<br />
Wenngleich Berlin in Sachen Feinstaub und Stickoxid<br />
nach wie vor ein massives Problem hat und bei der<br />
Problemlösung ziemlich ratlos erscheint, darf die<br />
Stadt bei der Kohlendioxid-Vermeidung als nationalerVorzeigeortgelten.<br />
Denn während Deutschland seine Klimaziele<br />
voraussichtlich verfehlen und den CO 2 -Ausstoß bis 2020 gegenüber<br />
1990 nicht um die angestrebten 40, sondern wohl nur um rund 32<br />
Prozent reduzieren wird, hatte Berlin allein bei der Stromerzeugung<br />
bereits vor vier Jahren eine Reduzierung um 46 Prozent erreicht.<br />
Konkret waren es sechs Millionen Tonnen Kohlendioxid weniger,so<br />
das Statistische Landesamt. Es geht also.<br />
Tatsächlich wird der größte Teil des in Berlin benötigten Stroms<br />
auch in der Stadt erzeugt. Mehr als 1000 Kleinst- bis Großkraftwerkegibt<br />
es hier.Sie vorallem produzieren zwei Drittel des Stroms,<br />
den die <strong>Berliner</strong> verbrauchen. Dabei ist Kohle auch in Berlin noch<br />
immer ein wichtiger Energieträger, aber nicht mehr lange. Denn<br />
während bundesweit ein Kohleausstieg im Jahr 2038 erwogen wird,<br />
ist dieser hier bereits seit fast drei Jahren beschlossene Sache. 2016<br />
hatten sich das Land Berlin und Grundversorger Vattenfall, der in<br />
der Stadt alle Großkraftwerke sowie etwa 60 kleinere Strommeiler<br />
betreibt, auf einen Kohleverzicht geeinigt.„Bis spätestens 2030 werden<br />
wir in Berlin aus der Steinkohle heraus sein“, sagte Vattenfall-<br />
Chef Magnus Hall kürzlich in einem Interview. Bei der Braunkohle<br />
ist das bereits geschehen. Im Mai 2017 wurde am Kraftwerk KlingenberginRummelsburgder<br />
letzte Kohlefrachter gelöscht. Seitdem<br />
wird dort nur noch Erdgas zu Wärme und Strom gemacht. Unter<br />
dem Strich dürfte sich die jährliche Kohlendioxid-Emission allein<br />
dort mindestens halbieren. Effekt: etwa 700 000 Tonnen CO 2 weniger.Eine<br />
Stadt wirdrauchfrei.<br />
Auch für die drei noch verbliebenen Steinkohle-Kraftwerke Reuter,<br />
Reuter West und Moabit ist der Anfang vom Ende bereits gemacht.<br />
Im zwischen Spree und Siemensstadt gelegenen Kraftwerk<br />
Reuter entsteht derzeit Deutschlands größter Power-to-Heat-Block.<br />
Knapp 100 Millionen Euro investiert<br />
Vattenfall in die Anlage,die den Steinkohlenblock<br />
des Heizkraftwerks ersetzen<br />
soll. Es ist eine ArtriesigerWasserkocher,<br />
der Strom inWärme umwandeln<br />
soll, wenn vorübergehend<br />
zu viel Strometwa ausWindkraftanlagen<br />
im Netz ist. „Eine effiziente und<br />
wirtschaftlich günstige Form,Energie<br />
zu speichern“, heißt es bei Vattenfall.<br />
Insgesamt will der schwedische Konzern<br />
bis 2022 zwei Milliarden Euro in<br />
Berlin investieren.<br />
Ist also alles perfekt? „Berlin<br />
macht einiges besser, aber längst<br />
nicht alles“, sagt Claudia Kemfert,<br />
Energieexpertin am Deutschen Institut<br />
für Wirtschaftsforschung (DIW).<br />
So attestiertsie Berlin in punkto Kohleausstieg<br />
einen deutlichen Vorsprung,<br />
die Emissionen seien erfolgreich<br />
gesenkt worden. „Aber Berlin<br />
kann deutlich mehr Energiewende<br />
wagen als derzeit“, sagt die DIW-Professorin<br />
und denkt an den Ausstieg<br />
auch aus dem fossilen Erdgas. „Je<br />
schneller,desto besser.“<br />
Tatsächlich ist der Anteil erneuerbarer<br />
Energien in Berlin gering. Wurden<br />
bundesweit im vergangenen Jahr<br />
35 Prozent des erzeugten Stroms aus<br />
Wind, Sonne oder Biogas gewonnen,<br />
so waren es in Berlin im Jahr 2017<br />
So wird der Strom in<br />
Berlin verteilt<br />
34707<br />
Kilometer Kabel und Leitungen<br />
sind in Berlin verlegt.<br />
80<br />
Umspannwerke gibt es in der<br />
Stadt sowie ...<br />
11000<br />
Netzstationen und ...<br />
16700<br />
Verteilerkästen.<br />
nicht einmal fünf Prozent. Dashat freilich Gründe,etwa dass in einer<br />
Großstadt kaum Platz für Windkraftanlagen ist. Die landeseigenen<br />
Stadtwerke haben daher auf Flächen der <strong>Berliner</strong> Stadtgüter südlich<br />
der Stadt eigene Windkraftanlagen mit einer Leistung von zwölf<br />
Megawatt installiert, die Strom nach Berlin liefern. Dennoch müsse<br />
sich Berlin mehr einfallen lassen, so Energieexpertin Claudia Kemfert:<br />
„Berlin sollte auf Biomasse setzen, die Gebäudeenergieeffizienz<br />
verbessernund insbesondereSolarenergie deutlich ausbauen.“<br />
Letzteres steht tatsächlich ganz oben auf der städtischen Energieagenda.<br />
„Solarcity“ heißt ein Masterplan, der bis zum Sommer<br />
ermitteln soll, wie viele der <strong>Berliner</strong> Dachflächen für die Photovoltaik<br />
genutzt werden könnten. Immerhin geht es dabei um ein Potenzial<br />
von insgesamt 2400 Hektar. Jedenfalls soll „möglichst<br />
schnell“ einViertel des in Berlin benötigten Stroms aus Sonnenkraft<br />
gewonnen werden.<br />
Darüber hinaus wird esumEffizienz, eine smarte Stadt und intelligente<br />
Energiesteuerung gehen. Dafür sind die Bedingungen<br />
hier gut. Schließlich gibt es in der Stadt mehr als 30 Forschungseinrichtungen,<br />
Universitäten und Hochschulen, die in den Bereichen<br />
Energie und Umwelt forschen. Zudem locken die Herausforderungen<br />
neue Akteure nach Berlin. Nach Angaben der hiesigen Wirtschaftsfördergesellschaft<br />
Berlin Partner haben sich allein in den<br />
vergangenen fünf Jahren mehr als 50 Unternehmen aus dem Bereich<br />
Energietechnik neu in der Stadt angesiedelt. Über 1000 Jobs<br />
und Investitionen von zusammen 130 Millionen Euro sind die unmittelbare<br />
Folgen. Und auch die einschlägige Start-up-Szene<br />
wächst. An fünf offenbar hoffnungsvollen Energie-Start-ups hat<br />
sich die landeseigene Investitionsbank Berlin schon mal beteiligt.<br />
NEU IN DER STADT<br />
Auto<br />
vom<br />
Discounter<br />
VonTheresa Dräbing<br />
Lidl vertreibt jetzt auch Autos.Seit<br />
dieser Woche können Kunden<br />
über die Internetseite des Discounters<br />
einen Leasingvertrag für einen<br />
Fiat 500 abschließen.Wiebei den Lebensmitteln<br />
handelt Lidl im Autogeschäft<br />
ebenfalls mit Discountpreisen:<br />
89 Euro nur soll der Wagen monatlich<br />
kosten. Im Komplettpaket für<br />
164 Euro monatlich wären auch die<br />
Kfz-Versicherung, Wartungskosten<br />
sowie Winterreifen enthalten. Eine<br />
Kampfansage an den Autohandel.<br />
Wassteckt dahinter?<br />
Der Kooperationspartner bei dieser<br />
Aktion ist das <strong>Berliner</strong> Start-upVehiculum.<br />
Dasjunge Unternehmen ist<br />
spezialisiert auf das Leasinggeschäft.<br />
Vehiculum beschäftigt 60 Mitarbeiter<br />
und hat seit der Gründung vor drei<br />
Jahren einen Umsatz von knapp 300<br />
Millionen Euro gemacht, bislang ausschließlich<br />
im Geschäftskundenbereich.<br />
Jetzt wollen sie auch in den Privatkundenbereich<br />
einsteigen. „Mit<br />
einer monatlichen Zahlung ist Leasing<br />
in Zeiten von Film- oder Musikstreaming-Anbietern<br />
zwar ultramodern,<br />
in der Anschaffung aber so<br />
kompliziert und unübersichtlich wie<br />
vor 20Jahren“, so Vehiculum-Gründer<br />
Lukas Steinhilber. Deshalb habe<br />
man den ganzen Prozess digitalisiert,<br />
ein Leasingvertrag könne innerhalb<br />
von 15Minuten online abgeschlossen<br />
werden. Beim Leasing erwerben<br />
Kunden die Nutzungsrechte für einen<br />
bestimmten Zeitraum, ähnlich wie<br />
bei einer Miete. Vehiculum fungiert<br />
dabei als Vermittler, den Vertrag<br />
schließt der Kunde mit der Santander-Bank.<br />
Die Autos stammen von<br />
größeren Autohändlern.<br />
Druck auf Händler wächst<br />
Die Kooperation mit Lidl verschafft<br />
dem Start-up Aufmerksamkeit. Autoexperte<br />
und Professor für Automobilwirtschaft<br />
an der Universität Duisburg-Essen<br />
Ferdinand Dudenhöffer<br />
hält das Angebot für „sensationell“<br />
und warnt zugleich: Zu dem Preis<br />
kann kein Händler mehr mithalten.<br />
„Autohändler im Neuwagenverkauf<br />
müssen sich überlegen, wie sie der<br />
neuen Konkurrenz begegnen“, sagt<br />
Dudenhöffer.<br />
Vehiculum ist nicht die einzige<br />
Plattform mit einem solchen Geschäftsmodell.<br />
Immer mehr Hersteller<br />
und Start-ups bieten Autos als<br />
Komplettpaket und im Abo an. „Dahin<br />
wird sich der Markt mehr und<br />
mehr entwickeln“, prognostiziert<br />
Dudenhöffer. Zumindest, so beobachtet<br />
er seit einigen Jahren, nimmt<br />
das Geschäft von Abos und Leasingmodellen<br />
zahlenmäßig zu.<br />
Den günstigen Preis könnten<br />
Start-ups wieVehiculum erzielen, indem<br />
sie an Verkaufsfläche, Vorführmodellen<br />
und anderen Dienstleistungen<br />
sparen. Nach Dudenhöffers<br />
Rechnung kalkulieren Neuwagenhändler<br />
etwa zehn Prozent des Verkaufspreises<br />
für diese Posten ein.<br />
Gleichzeitig bedeutet dies aber auch,<br />
dass im reinen Onlinegeschäft die<br />
Beratung und, zumindest bei der<br />
Lidl-Aktion, auch die Auswahl fehlt.<br />
Kunden können lediglich zwischen<br />
Farbe,Vertragslaufzeit und Laufleistung<br />
wählen. Die restliche Ausstattung<br />
ist bei allen Fiat-500-Wagen die<br />
gleiche.<br />
Vehiculum jedenfalls zeigt sich<br />
zufrieden. Bislang sei knapp für die<br />
Hälfte der 1000 Wagen ein Leasingvertrag<br />
zustande gekommen. Die<br />
Aktion läuft noch bis Ende April.<br />
VEHICULUM