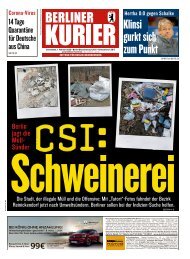Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Berliner</strong> <strong>Zeitung</strong> · N ummer 94 · M ittwoch, 24. April 2019 17 *<br />
·························································································································································································································································································<br />
Wissenschaft<br />
Arztbriefe aus<br />
der Klinik oft<br />
unverständlich<br />
Forscher befragten fast 200<br />
Hausärzte bundesweit<br />
VonDorothea Hülsmeier<br />
Wer nach einem Klinikaufenthalt<br />
beim Blick auf seine Entlassungspapiere<br />
nur Bahnhof versteht,<br />
ist bei weitem nicht der Einzige.Sogar<br />
vielen Hausärzten bereiten Arztbriefe<br />
aus dem Krankenhaus Kopfzerbrechen.<br />
Dabei sollten diese doch über<br />
Zustand und Therapie der Patienten<br />
informieren. Leider aber sind die Papiere<br />
häufig unstrukturiert, fehlerhaft,<br />
vage oder missverständlich formuliert.<br />
Sie enthalten unbekannte<br />
oder doppeldeutige Abkürzungen.<br />
Das ist das Ergebnis einer Befragung<br />
von bundesweit 197 Ärzten durch<br />
Sprachwissenschaftler der Heinrich-<br />
Heine-Universität Düsseldorf. Sie<br />
wurde in Zusammenarbeit mit Hausärzteverbänden<br />
durchgeführt.<br />
In der Befragung gaben 98,5 Prozent<br />
der Hausärzte an, Arztbriefe<br />
manchmal nicht auf Anhieb zu verstehen.<br />
Fast alle erhielten auch schon<br />
Papiere mit falschen Informationen.<br />
88 Prozent waren der Meinung, dass<br />
unverständliche oder fehlerhafte<br />
Arztbriefe zu Behandlungsfehlern<br />
führen können. Häufig müssen<br />
Hausärzte in der Klinik noch einmal<br />
nachhaken.<br />
„Hausärzte haben nicht die Zeit,<br />
stundenlang Arztbriefe zu lesen. Sie<br />
brauchen präzise und klareInformationen“,<br />
sagt der Linguist und Projektleiter<br />
Sascha Bechmann. „Dass<br />
solche Dokumente keinen Spielraum<br />
für Interpretationen geben<br />
dürfen, liegt auf der Hand.“ Bechmann<br />
vermutet, dass oft mit Textbausteinen<br />
gearbeitet wird, die von<br />
einem Brief in den anderen kopiert<br />
werden.<br />
EinSatz wie „Bei ausgeprägter Hyperhidrosis<br />
im Rahmen einer nicht<br />
senkbaren Hyperthermie wurde der<br />
Patient engmaschig bilanziert“, ist<br />
nur ein Beispiel für unverständliche<br />
Satzkonstruktionen. Und der Satz<br />
„Bei Zustand nach Schwindel mit<br />
nachfolgendem Sturz wurde eine<br />
Schwindeldiagnostik durchgeführt“<br />
entbehrt jeder Logik. Rechtschreibund<br />
Grammatikfehler sind weitere<br />
Kritikpunkte.<br />
Die Hausärzte monieren aber<br />
auch inhaltliche und fachliche Fehler,<br />
Widersprüche,Floskeln und fehlende<br />
Informationen. Etwa drei Viertel der<br />
Befragten nannten Therapieempfehlungen<br />
und Anweisungen zur Medikamenteneinnahme<br />
nach der Entlassung<br />
aus dem Krankenhaus als häufige<br />
Fehlerquellen. Dies sei ein großes<br />
Problem, wie Rudolf Henke, Vorsitzender<br />
des Marburger Bundes, sagt.<br />
Er vertritt unter anderem Klinikärzte.<br />
Es müsse dringend mehr direkte<br />
Kommunikation zwischen Hausund<br />
Krankenhausärzten organisiert<br />
werden, so Henke. „Aus Sicht des<br />
Marburger Bundes liegt es auch an<br />
den knappen Stellenplänen im Krankenhaus,<br />
wenn dafür heute nicht genug<br />
Zeit zurVerfügung steht.“<br />
Klinikärzte verbrächten pro Tag<br />
bis zu drei Stunden mit dem Verfassen<br />
der Briefe,soProjektleiter Sascha<br />
Bechmann. DieEmpfehlung der Forscher:Das<br />
Schreiben vonstrukturierten<br />
und verständlichen Arztbriefen<br />
sollte fest im Medizinstudium etabliertwerden.<br />
(dpa)<br />
Hausärzte sind auf korrekte Klinik-Informationen<br />
angewiesen. DPA/ROLF VENNENBERND<br />
Eine Wolkevon Flughunden am Abendhimmel des Kasanka-Nationalparks in Sambia. MAX-PLANCK-INSTITUT FÜR ORNITHOLOGIE/CHRISTIAN ZIEGLER (2)<br />
Nachtdienst fürs Ökosystem<br />
Fledermäuse und Flughunde bringen wertvolle Umwelt-Leistungen. Davon profitiert auch der Mensch<br />
VonKerstin Viering<br />
Ihre Stimmen sind nicht zu<br />
überhören. Ausden Bäumen im<br />
Nationalpark Kasanka in Sambia<br />
ertönt ein Zetern und Zwitschernwie<br />
voneinem riesigen Vogelschwarm.<br />
Doch die Gestalten, die<br />
hier voneinem Ast zum anderen flattern,<br />
haben ledrige Flügel, ein gelblich-graues<br />
Fell und ein fuchsähnliches<br />
Gesicht mit großen Augen. In einer<br />
der größten Tierwanderungen<br />
der Erde kommen jedes Jahr zwischen<br />
Oktober und Dezember bis zu<br />
acht Millionen Palmenflughunde –<br />
Eidolon helvum –aus anderen Regionen<br />
Afrikas in dieses Schutzgebiet.<br />
Sobald die Abenddämmerung hereinbricht,<br />
erheben sie sich in riesigen<br />
Wolken in den Himmel und flatternzuden<br />
Feigen und anderen Bäumen,<br />
um sich über Nacht den Bauch<br />
mit reifen Früchten vollzuschlagen.<br />
Bei diesen Fresstrips aber stillen<br />
die in Afrika weit verbreiteten Fledermaus-Verwandten<br />
nicht nur ihren eigenen<br />
Hunger.Gleichzeitig leisten sie<br />
auch wertvolle Dienste für ihren Lebensraum<br />
und die dort lebenden<br />
Menschen. Zu diesem Ergebnis<br />
kommt ein Team um Dina Dechmann<br />
vom Max-Planck-Institut für<br />
Ornithologie in Radolfzell und<br />
Mariëlle van Toor von der Linnaeus-<br />
Universität im schwedischen Kalmar<br />
im Fachjournal Current Biology.<br />
DieForscherinnen haben die ökologischen<br />
Auswirkungen verschiedener<br />
Palmenflughund-Kolonien in<br />
Westafrika untersucht. Demnach<br />
können die Bewohner einer solchen<br />
Kolonie in einer einzigen Nacht Hunderttausende<br />
von Samen verbreiten<br />
und damit zur Wiederbewaldung abgeholzter<br />
Flächen beitragen.<br />
Kein Tequila ohne Flattertiere<br />
Für diesen wichtigen Job sind Palmenflughunde<br />
besonders gut qualifiziert.<br />
Denn sie sind nicht nur sehr<br />
mobil, sondern mit einer Flügelspannweite<br />
von bis zu 76 Zentimeternauch<br />
relativ groß. Undesgibt gewaltige<br />
Mengen davon. Viele Millionen<br />
Tiere sollen durch die Regionen<br />
südlich der Sahara flattern. „Damit<br />
gehört diese Art zuden häufigsten<br />
Fruchtfressern Afrikas“, sagt Dina<br />
Dechmann.„Eine einzige Kolonie besteht<br />
aus Tausenden, manchmal sogar<br />
aus Millionen vonMitgliedern.“<br />
Für drei solcher Metropolen haben<br />
sie und ihre Kollegen nun die<br />
nächtlichen Flüge sämtlicher Bewohner<br />
mit einem neuen Computermodell<br />
simuliert. Dieses berücksichtigt<br />
nicht nur Erkenntnisse über die Nahrungs-<br />
und Fluggewohnheiten der<br />
Tiere und Beobachtungsdaten aus<br />
der jeweiligen Kolonie. Aus Experimenten<br />
ließ sich auch ableiten, wie<br />
lange die verschluckten Samen in<br />
Flattertiere.Die Chiroptera<br />
sind eine äußerst erfolgreiche<br />
Tiergruppe. Sie haben sämtliche<br />
Kontinenteaußer der<br />
Antarktis erobert und stellen<br />
mitmehr als 1300 bekanntenArten<br />
auchdie zweitgrößteSäugetier-Ordnung.<br />
Ein Palmenflughund mit Masuku-Frucht.<br />
Magen und Darm verweilen und<br />
wann sie ausgeschieden werden.<br />
Der Durchschnitts-Flughund besucht<br />
demnach bis zu drei Fruchtbäume<br />
proNacht und trägt deren Samen<br />
bis zu 95 Kilometer weit weg. Allerdings<br />
unterscheiden sich die Leistungen<br />
der fliegenden Transporteure<br />
je nach Jahreszeit. So halten sich in<br />
der untersuchten Kolonie in Ghanas<br />
Hauptstadt Accra während der Regenzeit<br />
nur rund 4000 Flattertiere<br />
auf, die pro Nacht etwa 5500 Samen<br />
verbreiten. In der Trockenzeit dagegen<br />
wächst die Flughund-Metropole<br />
auf 152 000 Mitglieder an, die in einer<br />
einzigen Nacht bis zu 338 000 Samen<br />
davontragen. Mitihrem Kotverteilen<br />
sie diese auf mehr als 800 Hektar ehemalige<br />
Waldgebiete, die zwischen<br />
2001 und 2016 gerodet wurden.<br />
Sollten diese Flächen eines Tages<br />
wieder komplett mit Bäumen bewachsen<br />
sein, würde die Bevölkerung<br />
davon enormprofitieren. „Sowärees<br />
zum Beispiel wieder möglich, dort<br />
Holz und Früchte zu nutzen, und der<br />
Regen würde nicht mehr so viele<br />
Nährstoffe aus den Böden herauswaschen<br />
wie derzeit“, erklärt Mariëlle<br />
vanToor.Durch solche Effekte ließen<br />
sich nach den Berechnungen des<br />
Teams zusätzliche Einkünfte von<br />
858 000 US-Dollar pro Jahr erzielen.<br />
Der Schutz der Flughund-Kolonien<br />
dürfte sich also auch aus wirtschaftlichen<br />
Gründen lohnen.<br />
MEHR ALS 1300 ARTEN<br />
Unterschiede. Fledermäuse<br />
und Flughunde unterscheidenen<br />
sich im Körperbauund vor<br />
allem in ihren Navigationstechniken.<br />
Fledermäuse orientieren<br />
sich mittelsEchoortung,<br />
Flughunde verlassen sich auf<br />
ihre großenAugen.<br />
Nahrung. Etwadrei Viertelaller<br />
Arten, darunter auchalle<br />
bei uns heimischen Fledermäuse,<br />
sindInsektenfresser.<br />
Eine Reihe tropischerund<br />
subtropischerArten,darunter<br />
die meisten Flughunde, leben<br />
dagegen vonFrüchten.<br />
Allerdings sieht es für die Zukunft<br />
der flatternden Dienstleister derzeit<br />
nicht besonders gut aus. „Seit es in<br />
Ghana kaum noch anderes Wild gibt,<br />
werden die Tiere dort stark bejagt“,<br />
berichtet Dina Dechmann. Dazu<br />
kommen die Abholzung vonWäldern<br />
und Quartierbäumen sowie die Verwendung<br />
der Tiereinder traditionellen<br />
Medizin. Das alles hat offenbar<br />
schon zu einem deutlichen Rückgang<br />
der Bestände geführt. So hielten sich<br />
in der Kolonie in Accra früher rund<br />
zehnmal so viele Tiereauf wie in letzter<br />
Zeit. Wenn sich dieser Trend fortsetzt,<br />
könnte das nach Einschätzung<br />
der Forscher fatale ökologische Folgen<br />
haben und auch zu wirtschaftlichenVerlusten<br />
führen.<br />
Ähnliches gilt auch für die Bestände<br />
anderer Flattertiere rund um<br />
die Welt. Der Höhlen-Langzungen-<br />
Flughund (Eonycteris spelaea) in Südostasien<br />
bestäubt zum Beispiel die<br />
Durian-Bäume,deren melonengroße<br />
Früchte in der Region hoch geschätzt<br />
und teuer gehandelt werden – ein<br />
Millionen-Geschäft, das ohne die Kooperation<br />
der nächtlichen Blütenbesucher<br />
nicht funktionieren würde.<br />
Genauso wenig wie die Tequila-Produktion<br />
in Mittelamerika. Denn dafür<br />
braucht man den Saft vonAgaven, die<br />
vonverschiedenen Blütenfledermäusen<br />
bestäubt werden.<br />
Doch auch die Leistungen der Insektenfresser<br />
können sich sehen lassen.<br />
Immerhin verschlingen sie in einer<br />
Nacht eine Insektenmenge, die<br />
etwa ein Drittel ihres eigenen Körpergewichts<br />
ausmacht. Und das macht<br />
sie zu sehr effektiven Schädlingsbekämpfern.<br />
Einen gewaltigen Appetit<br />
entwickeln zum Beispiel die etwa<br />
hundert Millionen Mexikanischen<br />
Bulldog-Fledermäuse (Tadarida brasiliensis),<br />
die in Höhlen im Norden<br />
Mexikos und im Süden der USA leben.<br />
Schätzungen zufolge sparen die<br />
Landwirte im Südwesten der USA allein<br />
durch die Aktivitäten dieser Flattertiere<br />
jedes Jahr eine halbe Million<br />
Dollar Ausgaben für Pestizide ein.<br />
Insgesamt sollen die Insektenfänger<br />
in den USA jedes Jahr Leistungen im<br />
Wert von mehr als drei Milliarden<br />
Dollar erbringen.<br />
Retter vonReispflanzen<br />
Anderen Studien zufolge verhindern<br />
die fast acht Millionen Fledermäuse<br />
Thailands im Durchschnitt einenVerlust<br />
von fast 3000 Tonnen Reis im<br />
Wert vonmehr als 1,2 Millionen Dollar<br />
proJahr.Damit schützen sie wahrscheinlich<br />
Nahrung für 26 000 Menschen.<br />
Und weltweit schätzen Forscher<br />
den Wert der Insektenvernichtung<br />
durch Fledermäuse allein für<br />
den Maisanbau auf mehr als eine Milliarde<br />
Dollar.<br />
„Für die europäische Landwirtschaft<br />
gibt es bisher erst wenige solcher<br />
Untersuchungen“, sagt Christian<br />
Voigt vom Leibniz-Institut für<br />
Zoo- und Wildtierforschung (IZW)in<br />
Berlin. Die aber zeigen, dass die<br />
nächtlichen Jäger auch in Europa Appetit<br />
auf Schädlinge haben. Im Kot<br />
von südeuropäischen Langflügelfledermäusen<br />
(Miniopterus schreibersii)<br />
hat ein Team um Antton Alberdi von<br />
der Universität Kopenhagen zum Beispiel<br />
DNA vonmehr als 200 Insekten-<br />
Arten gefunden, von denen 44 landwirtschaftliche<br />
Schäden anrichten.<br />
Undauch in deutschen Wäldernräumen<br />
Fledermäuse unter den krabbelnden<br />
Pflanzenfressernkräftig auf.<br />
Das haben Stefan Böhm von der<br />
Universität Ulm und seine Kollegen<br />
bei einem Experiment auf der Schwäbischen<br />
Alb und im Nationalpark<br />
Hainich in Thüringen herausgefunden.<br />
Mit Netzen haben sie dort die<br />
Kronen von Stiel-Eichen gegen die<br />
Besuche von Fledermäusen und Vögeln<br />
abgeschirmt und zwischen Juli<br />
und Oktober dreimal die Schäden an<br />
den Blätternermittelt. In allen Fällen<br />
wiesen diese Bäume eine größerebeschädigte<br />
Blattfläche und mehr Löcher<br />
pro Blatt auf als Vergleichsbäume<br />
ohne Netz. „Man darf Tiere<br />
natürlich nicht nur nach ihrem ökonomischen<br />
Nutzen beurteilen“, sagt<br />
Christian Voigt vom IZW. Für den<br />
Schutz von Fledermäusen aber gebe<br />
es schon aus rein wirtschaftlicher<br />
Sicht Gründe genug.<br />
Bis zu eine<br />
Million Arten<br />
bedroht<br />
Biodiversitätsbericht soll<br />
bald Details nennen<br />
Wegen der fortschreitenden<br />
Umweltzerstörung sind weltweit<br />
500 000 bis eine Million Tierund<br />
Pflanzenarten vom Aussterben<br />
bedroht. Viele dieser Arten drohten<br />
„in den kommenden Jahrzehnten“<br />
zu verschwinden, heißt in dem Entwurf<br />
eines Berichts zur weltweiten<br />
Artenvielfalt, wie die Nachrichtenagentur<br />
AFP am Dienstag berichtet.<br />
Den alarmierenden Report, der der<br />
AFP eigenen Angaben zufolge exklusiv<br />
vorlag, will die Zwischenstaatliche<br />
Plattform für Biodiversität und<br />
Ökosystemdienstleistungen (IPBES)<br />
–kurzWeltbiodiversitätsrat –bei einer<br />
Konferenz in Paris vorstellen. In<br />
Berlin soll er am 7. Mai präsentiert<br />
werden.<br />
Der IPBES mit Sitz in Bonn hatte<br />
2013 seine Arbeit aufgenommen. Bereits<br />
im März 2018 berichtete er auf<br />
seiner Konferenz in Kolumbien über<br />
einen alarmierenden Rückgang der<br />
Artenvielfalt. An den vier regionalen<br />
Berichten wirkten 550 Fachleute aus<br />
mehr als 100 Ländernmit. Einige Ergebnisse:<br />
In Afrika könnte bis zum<br />
Jahre 2100 mehr als die Hälfte der<br />
Vögel- und Säugetierarten verloren<br />
gehen. In Europa und Zentralasien<br />
waren im Zeitraum von 2007 bis<br />
2012 nur 16 Prozent der landlebenden<br />
Arten als „nicht gefährdet“ eingestuft.<br />
Im Asien-Pazifik-Raum wurden<br />
in den vergangenen 25 Jahren<br />
zwar die Meeresschutzgebiete um 14<br />
Prozent ausgedehnt. Allerdings<br />
könnten bis 2050 etwa 90 Prozent<br />
der Korallenbestände von einem<br />
massiven Rückgang bedroht sein.<br />
Dennoch äußerten die Forscher<br />
die Hoffnung, dass das Artensterben<br />
noch gebremst werden kann. „Es ist<br />
noch nicht zu spät“, sagte der IPBES-<br />
Vorsitzende Robert Watson. Dafür<br />
müssten mehr Schuztgebiete geschaffen,<br />
zerstörte Regionen wiederhergestellt,<br />
Landwirtschaftssubventionen<br />
überdacht werden. (AFP,BLZ)<br />
Dauertragen von<br />
Kopfhörern kann<br />
gefährlich sein<br />
Warnung von HNO-Ärzten<br />
zum Taggegen Lärm<br />
Viele Leute tragen heute Kopfhörer<br />
bei fast allen Gelegenheiten:<br />
beim Joggen, Radfahren, in der Bahn.<br />
Doch gerade in lauten Großstädten<br />
kann das dauerhafte Tragen von<br />
Kopfhörern gesundheitsschädlich<br />
sein. „Zu Hause startet man meist<br />
noch mit einer gesunden Lautstärke,<br />
dreht dann auf der Straße aber auf,<br />
um den Umgebungslärm zuübertönen“,<br />
sagte Michael Deeg, Sprecher<br />
des Deutschen Berufsverbands der<br />
Hals-Nasen-Ohrenärzte, anlässlich<br />
des Tages gegen Lärm amheutigen<br />
Mittwoch. „Langfristig können Hörschäden<br />
die Folge sein, die sich nicht<br />
mehr behandeln lassen.“<br />
Die Art des Kopfhörers spiele<br />
keine Rolle, sagte Deeg. „Wichtig ist,<br />
wie viel Schallenergie am Ohr ankommt<br />
und wie lange die Belastung<br />
dauert.“ Wichtig sei es, dauerhaft<br />
Lärm über 85 Dezibel zu vermeiden.<br />
Dasist etwa so laut wie der Geräuschpegel<br />
an einer Hauptverkehrsstraße.<br />
Auch eine kurzzeitige,starke Lärmbelastung<br />
–etwa bei einem Klub- oder<br />
Konzertbesuch –könne Schaden anrichten.<br />
Durch starke Schallwellen<br />
werden laut Deeg vorallem die feinen<br />
Haarzellen im Innenohr, die Sinneszellen<br />
geschädigt. „Bei hoher Schallenergie<br />
werden sie plattgedrückt wie<br />
das Getreide auf einem Feld bei einem<br />
starken Sturm“, sagt er. Oftmals<br />
richteten sich die Härchen wieder<br />
auf, allerdings nicht immer. (dpa)