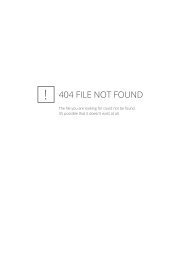ishlt - Pabst Science Publishers
ishlt - Pabst Science Publishers
ishlt - Pabst Science Publishers
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
transplantation aktuell - Sonderheft 2006<br />
durchaus angemessenen Gefühlen von Angst und<br />
Seelische Prozesse und<br />
Depression, Unsicherheit und Zweifeln inneren<br />
Langzeitüberleben nach<br />
Raum zu geben, damit sie seelisch bewältigt werden<br />
Herztransplantation<br />
können.<br />
Dr. med. Dipl.-Psych. Wolfgang Albert,<br />
Dipl.-Psych. Dipl.-Rehapäd.<br />
Herausforderung Herztransplantation<br />
Im Deutschen Herzzentrum Berlin (DHZB) wurde<br />
Christiane Gresch, Berlin<br />
eine umfangreiche Studie durchgeführt, bei der eine<br />
große Gruppe von HTx-Patienten von der Wartezeit<br />
auf die Verpflanzung bis zehn Jahre danach mittels<br />
ausführlicher Gespräche und Testverfahren begleitet<br />
wurde. Dabei zeigte sich, dass die Ängste und Befürchtungen<br />
in der Wartezeit ganz besonders groß<br />
sind, da die abnehmende körperliche Leistungsfähigkeit<br />
verbunden mit Atemnot, Schwächegefühl und<br />
Schmerzen Panikzustände und Todesängste hervor-<br />
TRANSPLANTATIONSMEDIZIN<br />
Das Herz hat in allen Kulturen stets eine herausragende<br />
Bedeutung als Zentrum des Lebens eingenommen<br />
und wurde sowohl als Inbegriff für Gemüt,<br />
Gefühl wie auch Einsicht und im weitesten Sinne als<br />
Sitz der Seele angesehen. In allen Kulturen rankten<br />
sich um dieses Organ viele Phantasien, Träume und<br />
Ängste. Einige Völker opferten beispielsweise das<br />
Herz als kostbarstes Organ an ihre Götter und in der<br />
christlichen Tradition ist es im Alten wie im Neuen<br />
Testament „das von Gott gebildete geistige Zentrum<br />
des Menschen“. Entsprechend gilt es vielen von uns<br />
– ob bewusst oder unbewusst - als ein Stellvertreter<br />
für die ganze Persönlichkeit. Dies findet sich auch im<br />
alltäglichen Sprachgebrauch in vielfältigen Sprichwörtern<br />
wieder, wie „da bricht mir das Herz“,<br />
„mein Herz blutet“, „du musst dein Herz in beide<br />
Hände nehmen“. Auf diesem Hintergrund erklärt<br />
sich auch die ganz besondere Bedeutung, die eine<br />
Verpflanzung des Herzens für die Betroffenen wie<br />
deren Familien einnimmt. Einerseits ist damit die Vorstellung<br />
verbunden eine schwere Krankheit zu überwinden<br />
und zugleich eine neue Lebensvitalität und<br />
Kraft bis hin zur Vorstellung einer Wiedergeburt,<br />
dem sogenannten „zweiten Geburtstag“ zu erreichen.<br />
Andererseits wird etwas „Fremdes in das Eigene“<br />
verpflanzt und muss zu einem Teil der eigenen<br />
Person umgewidmet werden.<br />
In den vergangenen 20 Jahren hat sich die Herztransplantation<br />
(HTx) zu einer ausgereiften Methode<br />
zur Behandlung von Patienten mit hochgradig eingeschränkter<br />
Herzleistung entwickelt, welche die körperliche<br />
Leistungsfähigkeit, das psychische Befinden<br />
und die Lebensqualität der Patienten langfristig in<br />
hohem Maße verbessert. Die psychische Auseinandersetzung<br />
mit der HTx beginnt bereits intensiv<br />
im Vorfeld des Eingriffs, denn es handelt sich dabei<br />
um eine „Grenzsituation par excellence“. Nach der<br />
Operation setzt sich der Prozess fort mit der Aufgabe<br />
das neue Organ in das seelische Körpererleben<br />
einzugliedern. Oftmals beschäftigt sich der Patient<br />
dabei mit Fragen nach der Herkunft des Organs und<br />
den Eigenschaften des Spenders. Die Integration eines<br />
fremden Herzens in das eigene Körperbild erfordert<br />
enorme Anpassungsleistungen. Die Lebens- und<br />
Todesängste, die ein solcher Eingriff hervorrufen<br />
kann, machen es für die Patienten somit in allen Phasen<br />
des Transplantationsprozesses, auch im späteren<br />
Lebensverlauf, immer wieder von Neuem notwendig,<br />
ein inneres Gleichgewicht herzustellen. Dabei<br />
ist es nach unseren Erfahrungen sehr wichtig, den<br />
rufen können. Erschwert wird diese Situation durch<br />
die Unbestimmbarkeit, wann ein Organ zur Verfügung<br />
stehen wird. Nach der HTx können auch Zustände<br />
von Verwirrtheit und in Einzelfällen Wahnvorstellungen<br />
auftreten, die aber in allen Fällen vollständig<br />
abklingen. Auch im späteren Verlauf ergeben<br />
sich gerade bei Abstoßungen oder Infektionen Krisensituationen,<br />
die für die Patienten wie ihre Angehörigen<br />
zu seelischen Belastungen führen. Einige Patienten<br />
versuchen durch eine rein rationale (vernunftgeleitete)<br />
und die Bedrohung verleugnende<br />
Verarbeitung die angstbesetzten Situationen durchzustehen.<br />
Dies hat sich aber nur bedingt als sinnvoll<br />
erwiesen, da man solche existenzbedrohenden Erkrankungen<br />
nicht auf Dauer aus der Seele aussperren<br />
kann. Vielmehr zeichnen sich die Patienten, die<br />
sehr lange die HTx überlebt haben vor allem dadurch<br />
aus, dass sie vor wie nach dem Eingriff auftauchende<br />
Gefühle der Traurigkeit, Angst und Hilflosigkeit<br />
„zulassen“ können, d.h. sich dazu bekennen<br />
und auch mit anderen teilen. Es wird oftmals übersehen,<br />
dass die Angehörigen (meistens Ehefrauen und<br />
Mütter) zutiefst von ähnlichen Sorgen und Zweifeln<br />
betroffen sind und man könnte sehr vereinfacht sagen,<br />
dass ein Teilen des Leides – wie im Sprichwort<br />
– halbes Leid bedeutet.<br />
Die Langzeit-Lebensqualität nach einer<br />
Herztransplantation<br />
In einer weiteren Studie am DHZB sind wir seit langem<br />
damit beschäftigt die Langzeitlebensqualität unserer<br />
Patienten 10 bzw. 20 Jahre nach HTx zu untersuchen.<br />
Unter Lebensqualität versteht man die persönliche<br />
Beurteilung der eigenen körperlichen und<br />
beruflichen Leistungsfähigkeit und des seelischen Befindens,<br />
die individuelle Lebenszufriedenheit, die<br />
empfundene Unterstützung durch die Familie und<br />
das soziale Umfeld. Zugleich beschäftigen wir uns<br />
mit den Langzeitauswirkungen der immunsuppressiven<br />
Medikamente und Folgeerkrankungen.<br />
Die bislang 125 untersuchten Patienten, welche länger<br />
als zehn Jahre nach der HTx leben, sind aktuell<br />
im Durchschnitt 54 Jahre alt. Sie beurteilen ihre Lebenszufriedenheit<br />
als überraschend gut, obgleich ih-<br />
25