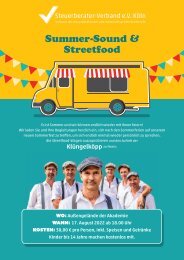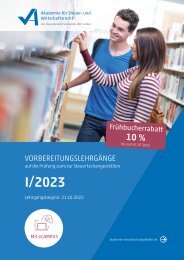VerbandsNachrichten 3 I 2021
VerbandsNachrichten 3 I 2021
VerbandsNachrichten 3 I 2021
- Keine Tags gefunden...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Europa I <strong>VerbandsNachrichten</strong> 3/<strong>2021</strong><br />
Bisher waren rund 11.700 Großunternehmen mit mehr als<br />
500 Beschäftigten vom Anwendungsbereich der NFRD betroffen.<br />
Nach dem Willen der EU-Kommission soll diese Schwelle<br />
von 500 Beschäftigten abgeschafft werden, damit zukünftig<br />
ca. 50.000 (Groß-) Unternehmen, davon allein ca. 15.000 in<br />
Deutschland, zur nicht-finanziellen Berichterstattung verpflichtet<br />
werden.<br />
Außerdem soll die Europäische Beratergruppe für Rechnungslegung<br />
(EFRAG) Standardentwürfe zur freiwilligen Angabe von<br />
nachhaltigem Wirtschaften für KMU ausarbeiten. Inwieweit solche<br />
Angaben für KMU allerdings tatsächlich freiwillig bleiben,<br />
darf bezweifelt werden. Vielmehr befürchtet der DStV, dass<br />
viele KMU, etwa als Lieferanten von Großunternehmen oder<br />
zur Finanzierung bei Kreditinstituten zur Übernahme entsprechender<br />
Nachhaltigkeitsstandards gedrängt werden.<br />
Einen Punkt des Kommissionsvorschlags sieht der DStV besonders<br />
kritisch: Den Mitgliedstaaten soll die Möglichkeit eingeräumt<br />
werden, den Markt für Dienstleistungen im Bereich der<br />
Nachhaltigkeitsbestätigung für sogenannte „unabhängige<br />
Bestätigungsdienstleister“ zu öffnen. Dadurch könnten auch<br />
geringqualifizierte Dienstleister anstelle der Abschlussprüfer<br />
damit beauftragt werden, die Qualität ihrer Nachhaltigkeitsinformationen<br />
zu bestätigen. Der DStV sieht im Falle der Verabschiedung<br />
einer solchen Neuerung insbesondere den deutschen<br />
Gesetzgeber in der Pflicht, die Vorbehaltsaufgaben der<br />
beratenden und prüfenden Berufe zu wahren. Insbesondere<br />
während der Pandemie hat sich das deutsche System mit seinen<br />
hochqualifizierten und praxiserfahrenen Steuerberatern und<br />
Wirtschaftsprüfern bestens bewährt.<br />
Die Europäische Staatsanwaltschaft nimmt ihre Arbeit auf<br />
Die EU rüstet im Kampf gegen Straftaten weiter auf. Seit dem<br />
01.06.<strong>2021</strong> verfolgt die Europäische Staatsanwaltschaft<br />
(EUStA) grenzüberschreitende Wirtschaftskriminalität.<br />
Es sind beeindruckende Zahlen, die das europaweit aktive<br />
Recherchenetzwerk correctiv.org zusammenfasst: Der EU entgehen<br />
durch Korruption, Geldwäsche und Betrug mit EU-Finanzmitteln<br />
jährlich bis zu 50 Milliarden Euro an Steuereinnahmen.<br />
Umsatzsteuerkarusselle verursachen zusätzlich in<br />
Deutschland einen jährlichen Schaden von geschätzt 5 bis 14<br />
Milliarden Euro.<br />
Der EU fehlte bis jetzt eine effektive Möglichkeit, Betrugsfälle<br />
im EU-Binnenmarkt grenzüberschreitend strafrechtlich zu<br />
verfolgen. Bestehende Behörden wie Europol, Eurojust, die<br />
Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU)<br />
und das Betrugsbekämpfungsamt der EU (OLAF) können zwar<br />
Verdachtsfälle an die nationalen Strafermittlungsbehörden<br />
weitergeben; grenzüberschreitend verfügen diese Agenturen<br />
jedoch über keine eigenen Ermittlungskompetenzen. Hier setzt<br />
die EUStA an und führt Untersuchungen und Strafverfolgungsmaßnahmen<br />
zu folgenden, gegen die finanziellen Interessen<br />
der EU gerichteten Betrugsdelikten und weiteren Straftaten<br />
durch:<br />
• Betrug im Zusammenhang mit Ausgaben und Einnahmen,<br />
• betrügerische Handlungen im Zusammenhang mit Umsatzsteuerabgaben,<br />
die mit zwei oder mehr Mitgliedstaaten<br />
verbunden sind und einen Gesamtschaden von mindestens<br />
10 Millionen Euro verursachen,<br />
• Geldwäsche von Vermögen, das aus gegen den EU-Haushalt<br />
gerichteten Betrugsdelikten stammt,<br />
• Bestechung, Bestechlichkeit und Veruntreuung zum Nachteil<br />
der finanziellen Interessen der EU,<br />
• Mitwirkung in einer kriminellen Vereinigung, deren Handlungen<br />
sich vornehmlich auf die Begehung von Straftaten<br />
zum Nachteil des EU-Haushalts konzentrieren.<br />
Unter Leitung der Europäischen Generalstaatsanwältin und<br />
ausgewiesenen Anti-Korruptionsexpertin Laura Kövesi entsendet<br />
jedes der 22 teilnehmenden EU-Mitgliedstaaten zwei<br />
Staatsanwältinnen bzw. Staatsanwälte an den luxemburgischen<br />
Sitz der neuen EU-Behörde.<br />
Der frühere Rostocker Staatsanwalt Andrés Ritter ist einer von<br />
ihnen und gleichzeitig ein Stellvertreter Kövesis. Den europäischen<br />
Staatsanwälten in Luxemburg werden sogenannte<br />
„delegierte Staatsanwälte“ in den teilnehmenden EU-Mitgliedstaaten<br />
zur Seite stehen. Die nationalen Justizsysteme<br />
komplementieren den überstaatlichen EuStA-Ansatz mit den<br />
nötigen finanziellen und administrativen Ressourcen unter<br />
Berücksichtigung der jeweiligen nationalen Rechtsvorschriften.<br />
Insgesamt soll die Behörde auf 140 ermittelnde Staatsanwälte<br />
in den nächsten Jahren anwachsen.<br />
Das Zustandekommen der EuStA<br />
Nachdem ein einstimmiger Beschluss im Europäischen Rat<br />
zur Schaffung der EuStA nicht zustande gekommen war, entschlossen<br />
sich 22 der 27 EU-Mitglieder im Zuge der „Verstärkten<br />
Zusammenarbeit“ zur Gründung der europäischen Staatsanwaltschaft.<br />
Polen, Ungarn, Schweden, Dänemark und Irland<br />
nehmen bislang nicht teil. Eine Mitgliedschaft zu einem späteren<br />
Zeitpunkt ist möglich. Die Nicht-Teilnahme entlässt die<br />
fünf Mitgliedstaaten jedoch nicht aus der Verantwortung, bei<br />
Verdachtsmomenten, wie bisher auch, über das etablierte<br />
System der Rechtshilfe und vertrauensvollen Zusammenarbeit<br />
im europäischen Rechtsraum mitzuwirken.<br />
59