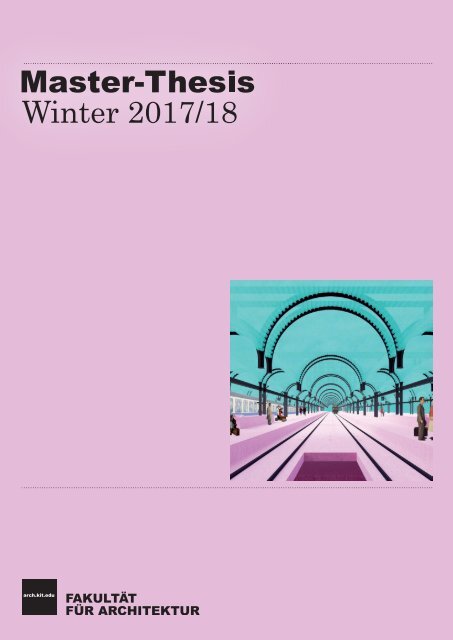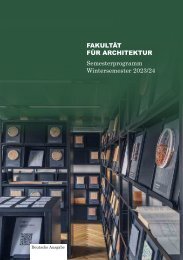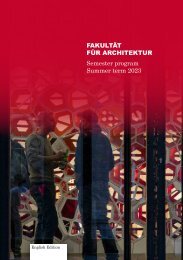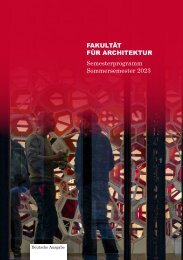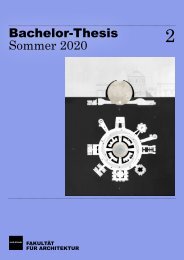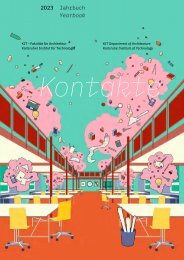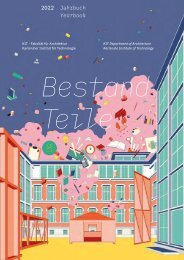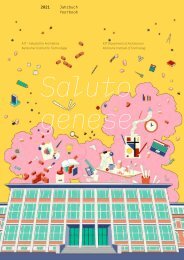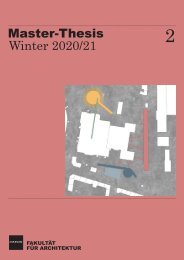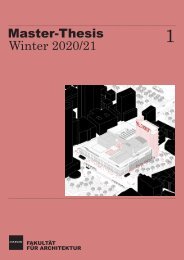KIT-Fakultät für Architektur – Master-Arbeiten Winter 2017/18
Dokumentation von Masterabschlussarbeiten des Wintersemesters 2017/18 an der Fakultät für Architektur am Karlsruher Institut für Technologie.
Dokumentation von Masterabschlussarbeiten des Wintersemesters 2017/18 an der Fakultät für Architektur am Karlsruher Institut für Technologie.
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Winter</strong> <strong>2017</strong>/<strong>18</strong>
<strong>Winter</strong>semester <strong>2017</strong>/<strong>18</strong><br />
Gabriela Lucinda Alcoba Guerrero, Maren Barczewski,<br />
Luca Bastian, Sarah Bastubbe, Hannah Becker, Johanna Borsch,<br />
Eva Botz, Jana Bräuner, Esra Cetin, Philipp Eckel, Anabel Egner,<br />
Carla Ertel, Nadine Fechti, Alexander Forsch, Valentina Fritscher,<br />
Maxim Gabai, Lukas Gerling, Lisa Gleiss, Tobias Güntert,<br />
Lisa Hartmann, Jeronimo Haug, Hannah Hollax, Katrin Kaiser,<br />
Lena Kaschube, Winta Kesete, Vilija Kiaunyte, Charlotte Knab,<br />
Christine Kohlmann, Desislava Kostadinova, Helen Kropp, Yuan Li,<br />
Ying Lin, Marc Lindenmeyer, Harriet Marina-Reitz, Sarah Mönch,<br />
Laura Müller, Torsten Neuberger, Julia-Katharina Ochmann,<br />
Maximiliane Ocker, Elke Gray Rossen, Svenja Sauer, Julia Schäfer,<br />
Elizabeth Scherzer, Janine Schwarzkopf, Lucy Sommavilla,<br />
Kristin Stiefvater, Peter Trauth, Marie Valet, Zhizhong Wang,<br />
Karin Weber, Xinyuan Zhang
GSEducationalVersion<br />
H<br />
H<br />
H<br />
Z1<br />
H<br />
Z2<br />
H<br />
Z3<br />
Z4<br />
Z5<br />
Z6<br />
Die Stadt teilen!<br />
Sarah Bastubbe<br />
Internationaler Städtebau<br />
Prof. Barbara Engel<br />
<strong>Architektur</strong>kommunikation<br />
Prof. Riklef Rambow<br />
Parkplätze<br />
Kreuzfahrtterminal<br />
Warenumschlagszentrum<br />
1 2<br />
Hafenterrassen<br />
Aussichtskran<br />
Getreidespeicher<br />
Stadtterminal<br />
Sitzstufen<br />
Parkhaus<br />
Bahnhof<br />
Kiosk<br />
Wasserspiele<br />
Hafengarten<br />
Hafenrestaurant<br />
Markt +<br />
Fischmarkt<br />
(Fisch-)Markt<br />
Junges Wohnen<br />
Platz der Kulturen<br />
Open Air<br />
Bühne<br />
Kulturforum<br />
Flohmarkt<br />
Bezirksregierung<br />
Büros<br />
Kindergarten der<br />
Kulturen<br />
TG<br />
Shopping Center<br />
Kontextuelles<br />
Grundgerüst<br />
Grenzräume<br />
bieten<br />
Grenzen gezielt<br />
passieren<br />
Begegnung und<br />
neutrale Räume<br />
Gericht<br />
Museum<br />
3 4<br />
Rathaus<br />
Mit der <strong>Master</strong>thesis wurden zunächst verschiedene<br />
Grenzen und Grenzräumen weltweit<br />
untersucht. Mit den Erkenntnissen als Basis,<br />
sollte in Haifa - Israel, der Versuch gemacht<br />
werden, durch Grenzen an den richtigen Stellen<br />
im urbanen Raum die Begegnungen seiner<br />
Bewohner zu fördern. Nach Analysen zu den<br />
Themen Stadtviertel, Identitäten, Austausch,<br />
Grenzen und Zugänglichkeiten, wird die<br />
Besonderheit im städtischen Zentrum Haifas<br />
ersichtlich: einige Viertel und Gruppen formen<br />
Grenzen geknüpft an ihre Identität, ihre<br />
Traditionen und Lebensstile, die sie voneinander<br />
unterscheiden lässt. Die Potentiale im<br />
Stadtzentrum Haifas liegen in den verschiedenen<br />
Vierteln und unterschiedlichen Gruppen,<br />
die dicht zusammenleben. Einige Begegnungsstätten<br />
sind bereits vorhanden, sodass ein<br />
Austausch untereinander entstehen kann.<br />
Insgesamt wirkt die Stadt fragmentiert, sogenannte<br />
landmarks prägen das Stadtbild. Auch<br />
physische Barrieren spielen eine Rolle. So ist<br />
gerade Haifas Lage nicht sinnvoll ausgenutzt,<br />
die Küste und das Meer sind selten zugänglich<br />
oder nur erschwert zugänglich durch Transportwege<br />
und Straßen. Das Entwurfskonzept<br />
schlägt ein übergeordnetes System von<br />
Achsen, Frei- sowie Grünräumen vor, die den<br />
weiten Stadtraum gliedern und verbinden. Dabei<br />
orientiert sich die Idee an den landmarks,<br />
die ebenfalls zusammenfassend wirken. In<br />
Kombination mit urbanen, nutzbaren Plätzen,<br />
einer Neugestaltung des Hafenareals, sowie<br />
ausgewählten Angeboten an Freizeit, Kultur<br />
und Dienstleistungen wird eine verbindende<br />
Zonierung ausgebildet. Diese zieht an einigen<br />
Aussichts<br />
plattform<br />
Stellen und <strong>für</strong> einige Viertel Grenzen neu<br />
Museum<br />
und schafft an anderer Stelle neuen Begegnungsraum<br />
(Platz der Kulturen). Es sollte<br />
Lagerhallen<br />
keine reine Integration sondern Diversität<br />
Talpiot Markt<br />
und Pluralität, also gerade die herrschenden<br />
Unterschiede, gestärkt und bevorzugt werden.<br />
Positive Grenzen zur Erfüllung der jeweiligen<br />
Bedürfnisse können bei der Planung im<br />
städtischen Raum eine wichtige Komponente<br />
spielen, die künftig präziser miteinbezogen<br />
werden sollte.<br />
1) Vertiefung_Platz der Kulturen<br />
2) Rahmenplan<br />
3) Zielsetzung<br />
4) Lageplanausschnitt
Kulturzentrum München Schwabing<br />
Eva Magdalena Botz<br />
Gebäudelehre<br />
Prof. Meinrad Morger<br />
Landschaftsarchitektur<br />
Prof. Henri Bava<br />
1<br />
2<br />
4<br />
3 5<br />
Die <strong>Master</strong>arbeit widmet sich mit der Planung<br />
eines Kulturzentrums <strong>für</strong> München Schwabing<br />
einer gleichermaßen ursprünglichen wie aktuellen<br />
Thematik. Ursprünglich im Sinne des<br />
Grundbedürfnisses des Menschen nach Raum<br />
<strong>für</strong> Kommunikation und Austausch - aktuell<br />
in Hinblick auf eine zunehmende Chance der<br />
Einflussnahme durch kulturelle Einrichtungen<br />
auf gegenwärtige gesellschaftliche sowie stadträumliche<br />
Entwicklungen.<br />
Der fortschreitende Wertewandel, insbesondere<br />
verbunden mit dem hohen Anspruch an<br />
Lebensqualität und Entfaltungsmöglichkeiten,<br />
verlangt nach neuen Identifikationsräumen in<br />
den Städten und Quartieren. Das Kulturzentrum<br />
München Schwabing ist als solcher Ort<br />
der Unterhaltung, der Begegnung und des Austausches<br />
wichtiger Baustein der Zukunft.<br />
Es ist sowohl ein Haus der raumbasierten<br />
Künste wie der Fotografie und der Bildenden<br />
Kunst, als auch der zeitbasierten Künste wie<br />
der Musik, des Videos und der Performance.<br />
Die Arbeit des Kulturzentrums vereint Veranstaltung<br />
und Ausstellung mit Produktion,<br />
Vermittlung und kreativer Bildung. Das Kulturzentrum<br />
ist Plattform <strong>für</strong> den Austausch<br />
verschiedener Künstlergruppen sowie dem<br />
Austausch zwischen Künstlern und Laien aller<br />
Altersklassen und damit vor allem Ort der<br />
Kommunikation.<br />
Die Multifunktionalität des Gebäudes und<br />
die Flexibilität seiner Räumlichkeiten sind<br />
notwendige zeitgemäße Antworten auf die<br />
differenzierter werdenden Ansprüche an den<br />
Freizeitwert und die Kommunikationsmöglichkeiten<br />
in Städten sowie die sich ständig verändernden<br />
Anforderungen durch die Kurz- und<br />
Schnelllebigkeit einer modernen Gesellschaft<br />
und gewährleisten damit die Zukunftsfähigkeit<br />
des Gebäudes.<br />
1) Städtebauliche Situation<br />
2) Grundriss EG<br />
3) Schnitt Ost-West<br />
4) Innenperspektive<br />
5) Modellfoto
<strong>Master</strong>arbeit _Philipp Eckel (1658513)_Fachgebiete R+E, Prof. Marc Frohn_Prof und <strong>Architektur</strong>theorie, Prof. Dr. Georg Vrachliotis<br />
Sunset 1025, Los Angeles<br />
Philipp Eckel<br />
Raum und Entwerfen<br />
Prof. Marc Frohn<br />
<strong>Architektur</strong>theorie<br />
Prof. Dr. Georg Vrachliotis<br />
1<br />
METRISCHE MONTAGE: RASTER<br />
RAUM ALS GENERIKUM<br />
4<br />
3<br />
2<br />
5<br />
Ausgangspunkt des Entwurfes „Sunset 1025“<br />
war die theorethische Auseinandersetzung mit<br />
Film.- und Medientheorie. Einerseits bildet<br />
Marshall Mcluhans „The Medium is the Message“<br />
Grundlage <strong>für</strong> das <strong>Arbeiten</strong> zwischen<br />
zwei Medien. Auf der anderen Seite wird<br />
durch Gilles Deleuzes „Kino 1: Das Bewegungs-Bild“<br />
und „Kino 2: Das Zeit-Bild“<br />
die Zusammensetzung von „Bildern“ im Film<br />
erläutert.<br />
Ziel der Auseinandersetzung mit Filmtheorie<br />
ist es Konzepte <strong>für</strong> eine vielfältige Gesellschaft<br />
zu finden, in welcher Wohnungsbau nicht nur<br />
<strong>für</strong> nuklear Familien oder Singles konzipiert<br />
wird, sondern sich auf jegliche Wohnkonstellationen<br />
einlassen kann. Film wird als Medium<br />
ausgewählt da es sich um ein Medium handelt<br />
welches selber durch die Zusammensetzung<br />
mehrere nicht umbedingt ähnlicher Aufnahmen<br />
eine Szene bildet. Diese dann mit anderen<br />
Szenen zusammenkommen und so aus<br />
vielen Teilen ein Ganzes bildet. Somit hat man<br />
ein Medium vor sich, welches durch die Konfiguration<br />
verschiendster Teile aus arbeitet.<br />
Um diese Elemente zusammenzubringen ist<br />
der Filmschnitt/montage vorhanden.<br />
Das Gebäude ensteht dann durch die Übertragung<br />
und somit verräumlichung 5 verschiedener<br />
Montagetechniken, welche 1929 von dem<br />
sovietischen Filmemacher Sergej Eisenstein<br />
definiert werden. Jede einzelne dieser ist in<br />
einem Bereich des Gebäudes vorhanden, und<br />
zusammen bilden sie einen Wohnungsbauhybrid<br />
(Wohnen + Stripmall) welcher sich entlang<br />
des Sunset Boulevards, direkt an einer Autobahnkreuzung<br />
befindet.<br />
1) Beispiel des Grundrisssystemes anhand von 4.Og<br />
2) Montage Diagramm zur Metrischen Montage<br />
3) Innenraum Stripmall<br />
4) Visualisierug Sunset Richtung Echo Park<br />
5) Innenraum Wohnen
Kulturwerkstatt Europa<br />
Anabel Egner<br />
Fachgebiet Gebäudelehre<br />
Prof. Meinrad Morger<br />
Fachgebiet <strong>Architektur</strong>kommunikation<br />
Prof. Dr. Riklef Rambow<br />
1 2<br />
3<br />
4<br />
5 6<br />
Die Idee <strong>für</strong> die Kulturwerkstatt Europa entstand<br />
durch die Betrachtung eines Sprachenzentrums<br />
als Schnittstelle interkultureller<br />
Begegnungen. Fremdspracheninteressierte<br />
unterschiedlicher Herkunft und Altersklassen<br />
treffen hier aufeinander. Vorallem <strong>für</strong><br />
Austauschpartner und Migranten stellt die<br />
Einrichtung eines der ersten Anlaufstellen in<br />
einer Stadt dar. Von dieser Situation wollte<br />
ich daher gerne Gebrauch machen und einen<br />
Ort schaffen, an dem interkulturelle Kommunikation<br />
stattfinden kann.<br />
In meiner theoretischen Ausarbeitung erläutere<br />
ich, wie Kommunikation eine Kultur bilden<br />
kann. Daher stellt die Sprachenschule <strong>für</strong><br />
mich auch ein Kulturzentrum dar.<br />
Aber auch die Funktionen eines Kulturzentrums<br />
soll der Kulturwerkstatt innewohnen.<br />
Gelerntes soll durch aktives Handeln im selben<br />
Raum erstellt, ausgestellt und weitergegeben<br />
werden.<br />
Die Einrichtung hat damit <strong>für</strong> mich einen<br />
völkerverbindenden Charakter.<br />
Angesichts aktueller Ereignisse habe ich mich<br />
daher dazu entschieden, die Veränderung in<br />
der europäischen Gesellschaft in meine <strong>Master</strong>arbeit<br />
mitaufzunehmen.<br />
<strong>Architektur</strong> ist <strong>für</strong> mich zugleich eine Form<br />
als auch Produkt kommunikativer Handlungen.<br />
Sie ist ein Medium, welches eine Vielzahl<br />
von Menschen miteinschließt.<br />
Dadurch habe ich folgendes Konzept entworfen.<br />
Die „Kulturwerkstatt Europa“ zeichnet<br />
sich durch drei unterschiedliche Raumsysteme<br />
aus, welche sich auf dasselbe Raster beziehen.<br />
Die Erdgeschosszone ist durch ein offenes<br />
Stützenraster geprägt, welches <strong>für</strong> den Besucher<br />
offen und einladend wirken soll. Die<br />
Obergeschossfläche zeichnet sich durch die<br />
Typologie der Kammerung aus. Im Dachgeschoss<br />
befinden sich solitäre Baukörper, die<br />
durch einen fließenden Raum miteinander<br />
verbunden sind.<br />
1) Grundriss EG, Veranstaltungsbereich<br />
2) Ansicht Nord<br />
3) Grundriss OG, Ausstellung<br />
4) Längsschnitt<br />
5) Grundriss DG, Sprachenschule<br />
6) Perspektive Stützenraster
Kontaktzone Bahnhof Konstanz -<br />
Vom Transitort zum Bindeglied<br />
Nadine Fechti<br />
Gebäudelehre<br />
Prof. Meinrad Morger<br />
Stadtquartiersplanung<br />
Prof. Markus Neppl<br />
1<br />
2<br />
3<br />
4 5<br />
Die <strong>Master</strong>arbeit beschäftigt sich mit der<br />
Entwicklung mittelstädtischer Bahnhöfe unter<br />
gleichzeitiger Betrachtung der Entwicklung<br />
der Gesellschaft. Ein Blick auf das heutige<br />
Erscheinungsbild wie hier exemplarisch<br />
der Bahnhof in Konstanz zeigt, dass unsere<br />
Gesellschaft hier mehr schlecht als recht<br />
repräsentiert wird und der Bahnhofs selbst<br />
keinen erkennbaren Mehrwert im Stadtgefügt<br />
darstellt.<br />
Das Bahnhofsareal trennt die historische<br />
Altstadt und den See und dient lediglich als<br />
reiner Transitort ohne wirkliche Aufenthaltsqualitäten.<br />
Das Ziel der Arbeit ist daher, die<br />
Verbindung durch das Areal wiederherzustellen<br />
und durch neue Bausteine einen Mehrwert<br />
<strong>für</strong> die Stadt zu erzeugen.<br />
Die Schnittstelle der Verkehrsmittel bietet<br />
hervorragende Standortfaktoren und somit<br />
einen Potentialraum <strong>für</strong> Experimentierflächen<br />
und als Erststandort <strong>für</strong> Existenzgründer.<br />
Hierdurch kann das Mobilitätszentrum auch<br />
zu unterschiedlichen Tageszeiten und von unterschiedlichen<br />
Nutzern frequentiert werden.<br />
Durch die Nähe zu den Publikumsmagneten<br />
am See und in der Altstadt besteht des Weiteren<br />
die Möglichkeit <strong>für</strong> ein Bahnhofshotel,<br />
was den Ansprüchen aller Nutzergruppen<br />
gerecht werden sollte. Entscheidend ist, die<br />
Erdgeschosszone im gesamten Areal möglichst<br />
öffentlich zu halten und dennoch unterschiedliche<br />
Aufenthalts- und Nutzungszonen zu<br />
generieren.<br />
Durch eine neue Unterführung im historischen<br />
Empfangsgebäude selbst, wird die<br />
städtebauliche Achse von der Altstadt bis<br />
zum Hafen aufgegriffen und die Verbindung<br />
ermöglicht.<br />
Um größere Bauvolumen zu ermöglichen und<br />
dennoch die Körnung der Altstadt zu übertragen<br />
wurde das Satteldach aufgegriffen.<br />
Mit den neuen Bausteinen steht das Areal<br />
nun <strong>für</strong> den Vermittler und das verbindende<br />
Element zwischen Kultur und Konsum, Arbeit<br />
und Freizeit sowie Stadt und Region.<br />
1) Ansicht Ost<br />
2) Grundriss EG<br />
3) Sichtbezug Mobilitätszentrum<br />
4) Gesamtkonzeption Bahnhof Konstanz<br />
5) Ankunftssituation Gleis 1
SAI GON<br />
Nhá Mày Tài Chế<br />
- Rethinking Material Flows and Urban Manufacturing<br />
Alexander Forsch<br />
Nachhaltiges Bauen<br />
Prof. Dirk E. Hebel<br />
<strong>Architektur</strong>kommunikation<br />
Prof. Riklef Rambow<br />
INFORMELLE STRATEGIEN<br />
2<br />
VORSCHLAG FASSADE<br />
3<br />
1 4<br />
5<br />
6<br />
17 8 9<br />
Nhá Mày Tài Chê untersucht Materialflüsse<br />
im urbanen Kontext und aktuelle digitale<br />
IPHONE CITY<br />
Fertigungstechniken um Möglichkeiten zu<br />
erforschen, den derzeitigen und Bauboom in<br />
Schwellenländern des globalen Südens nachhaltiger<br />
zu gestalten.<br />
In informellen Siedlungen, bspw. in Vietnam,<br />
findet sich eine stark verbreitete Recyclingkultur,<br />
die in vielen Aspekten der westlichen<br />
Konsumverhalten überlegen ist. Die Kreativität<br />
die begrenzt vorhandenen Materialien zu<br />
nutzen und wiederzuverwerten, kleinteilige<br />
urbane Produktionsstätten und Recyclingshops,<br />
vielschichtige Netzwerke <strong>für</strong> eine<br />
dynamische Abfallwirtschaft und eine individualisierte<br />
(improvisierte) gestaltete gebaute<br />
Umwelt ähnelt in bestimmten Aspekten stark<br />
aktuellen Entwicklungen im Westen, dem<br />
Maker-Movement, der vernetzten Stadt &<br />
nachhaltiger urbaner Produktion.<br />
Anstatt der Kultur VISIONdie Dogmen einer Entwicklung<br />
nach westlichem, industriellen Vorbild<br />
aufzuerlegen, ist es das Ziel diese vorhandenen<br />
Typologien, Netzwerke und Bauweisen ins<br />
21. Jahrhundert zu transferieren. Der theoretische<br />
Teil der Arbeit versucht ein Verständnis<br />
<strong>für</strong> die Lebensweise, Alltagsroutine, Traditionen<br />
und Werte in Vietnam zu extrahieren und<br />
daraus Werkzeuge <strong>für</strong> eine architektonische<br />
Aufgabe zu entwickeln.<br />
In dem konkreten Beispiel wird exemplarisch<br />
drei leer stehende Gebäude in einer vietnamesischen<br />
Hém Siedlung zu einem Waste Lab<br />
transformiert, einer modernen urbanen Fabrik<br />
mit Werrtstoffhof. Durch Entkernen, Rückbau<br />
und Re-organisation des Bestandes und dem<br />
Einsetzen einer neuen Infrastruktur ist es<br />
möglich ein Grundgerüst aufzubauen, dass<br />
sich immer wieder anpassen, weiterentwickeln,<br />
ergänzen aber auch zurückbauen kann.<br />
Eine digitale stadtübergreifenden Plattform,<br />
die Kunden, Abfallstoffe / Ressourcen und<br />
Fertigungsprozesse lokal verknüpft und eine<br />
dynamische Kreislaufwirtschaft ermöglicht.<br />
1) Straßenperspektive<br />
2) Informelle Vietnamesische Hèm Siedlung<br />
3) Querschnitt<br />
4) Ho Chi Minh City - District 4<br />
5) Strassenansicht<br />
6) Weiterentwickelte Hèm Siedlung<br />
7) Innenperspektive Produktion & Showroom<br />
8) Sädtebauliche Typologien und Entwicklungen<br />
9) Hybride Urbane Produktionsstätten
Cloud Necropolis, Berlin<br />
Maxim Gabai<br />
Raum und Entwerfen<br />
Prof. Marc Frohn<br />
<strong>Architektur</strong>theorie<br />
Prof. Dr. Georg Vrachliotis<br />
1<br />
2<br />
Cloud Necropolis Maxim Gabai 1680782<br />
<strong>Winter</strong>semester <strong>2017</strong>/<strong>18</strong><br />
Im Turm<br />
Fachgebiet Raumgestaltung Prof. Marc Frohn<br />
Fachgebiet <strong>Architektur</strong>theorie Prof. Georg Vrachliotis<br />
3 4<br />
Cloud Necropolis Maxim Gabai 1680782<br />
<strong>Winter</strong>semester <strong>2017</strong>/<strong>18</strong><br />
Blick auf Mauer<br />
Fachgebiet Raumgestaltung Prof. Marc Frohn<br />
Fachgebiet <strong>Architektur</strong>theorie Prof. Georg Vrachliotis<br />
The cemetery is and always been a special<br />
place in every culture: necessary, sacred, frightening<br />
and representative. The cemetery<br />
and the funerary cult in Germany are changing<br />
and therefore is in need of a new type of<br />
cemetery. In earlier days families,<br />
faith communities or the state took care of the<br />
deceased in Germany. Certain rituals were<br />
practiced dogmatically and there was the<br />
typical picture of a grave covered by flowers,<br />
a rich decorated gravestone and of a willowy<br />
Graveyard. But in today’s reality the former<br />
forms of funeral and cemetery don’t work anymore.<br />
As the welfare of the Communities falls<br />
apart and the structures of families<br />
become looser, the current state of funerary<br />
cults of today seems to be inoperative for Germany.<br />
The consequences are that many<br />
people are buried anonymously or cremated<br />
to keep the maintain costs low or are interred<br />
elsewhere. Cemeteries are forced to<br />
shrink or must close due to low occupancy<br />
rate. The other aspect of today society is that a<br />
lot of mourning is expressed not at the<br />
cemetery but via Internet in social media or<br />
elsewhere. For many people the internet is<br />
becoming the place of remembrance, grief<br />
and condolence instead of the cemetery. As we<br />
see the signs of decay of cemeteries in Germany,<br />
we must admit, that the cemetery<br />
is a very special place in the city: As a Green,<br />
collective and heterotopic space it holds great<br />
value for the city and enriches the city<br />
on many levels. So, the question should be how<br />
we can adapt the typology of the cemetery for<br />
the future, so that the disposal of<br />
bodies doesn’t just be-come a technical solution<br />
without further influence on the city and<br />
people?<br />
The approaches that are used in my design are<br />
not science fictional but are in parts already<br />
used: as the alkali hydrolysis, the full<br />
digitalization of a person and the active responding<br />
digital persona are existing right now<br />
and are used in other fields.<br />
The design shows how such a cemetery could<br />
look in the future.<br />
1) Grundriss<br />
2) Axonometrie<br />
3) Perspektive Turm<br />
4) Perspektive Park
D<br />
D<br />
GSEducationalVersion<br />
GSEducationalVersion<br />
GSEducationalVersion<br />
ZUKUNFT FESSENHEIM, Fessenheim (F)<br />
Lukas Jonathan Gerling<br />
Nachhaltiges Bauen<br />
Prof. Dirk E. Hebel<br />
Landschaftsarchitektur<br />
Prof. Henri Bava<br />
1 2<br />
3<br />
4<br />
7<br />
6 8<br />
5<br />
9 10<br />
Das Kernkraftwerk Fessenheim liegt in der<br />
Oberrheinregion zwischen Mulhouse, Freiburg<br />
und der Schweiz. Durch das Kernkraftwerk,<br />
das Wasserkraftwerk und die vielen Hochspannungsmasten<br />
entsteht ein Bild einer<br />
kraftvollen Energielandschaft. Diese steht in<br />
Kontrast zu dem kleinen Dorf Fessenheim und<br />
der ausgeprägten Landwirtschaft.<br />
Um die vorhandene Infrastruktur weiter zu<br />
verwenden und einige Bestandsgebäude erhalten<br />
zu können wird ein Forschungscampus <strong>für</strong><br />
Energiespeicherung vorgeschlagen. Nördlich<br />
des Areals befindet sich aktuell das maison<br />
d‘énergie <strong>–</strong> ein Infozentrum über die beiden<br />
Kraftwerke. Angrenzend wird das deutschfranzösische<br />
Gewerbegebiet entstehen. Des<br />
weiteren wird das eigentliche Kernkraftwerk<br />
zu einem Ort <strong>für</strong> Freizeit und Kultur.<br />
Diese Orte werden mit Hilfe eines Landschaftsstegs<br />
miteinander verbunden.<br />
Die bestehende Zugverbindung wird weiter<br />
durch das Areal geführt, bindet gleichzeitig<br />
das neue Gewerbegebiet an und führt durch<br />
Fessenheim auf die ehemals von den Deutschen<br />
gebaute Bahnstrecke nach Breisach.<br />
Die Grundstrukturen der Turbinenhalle und<br />
der Reaktoren werden erhalten. In der Turbinenhalle<br />
wird ein Museum, ein Bistro, ein<br />
großer Veranstaltungssaal, ein Jugen- & Kultur<br />
Haus und zwei Ateliergebäude angesiegelt.<br />
Außerdem entstehen auf unterschiedlichen<br />
Ebenen Sport und Pflanzfelder. So entsteht ein<br />
großer öffentlicher Raum, der die unterschiedlichen<br />
Nutzungen miteinander verbindet.<br />
Gleichzeitig gehen von der Hauptebene die<br />
verschiedenen Stege ab.<br />
Bei den Reaktorgebäuden bleibt die raumbildende<br />
Tragstruktur erhalten. Die Räume<br />
sollen als eine Art Mahnmal an die Kernenergie<br />
erinnern. Ein Steg führt jeweils in die<br />
Mitte des Raumes und durch unterschiedliche<br />
Lichtstimmungen nimmt der Besucher die<br />
Räume unterschiedlich war.<br />
1) Lageplan 7) Aktivitätsfeld Konzert<br />
2) Modellbild 8) Kletterwand-Fassade<br />
3) Längsschnitt 9) Perspektive Turbinenhalle<br />
4) Querschnitt 10) Perspektive Reaktor-Mahnmal<br />
5) Erdgeschossgrundriss<br />
6) Explosionszeichnung
ion<br />
1405.58.60.100<br />
Neuinterpretation Schwarzwaldbauten, Grafenhausen<br />
Tobias Güntert<br />
Nachhaltiges Bauen<br />
Prof. Dirk E. Hebel<br />
Bauphysik & Technischer Ausbau<br />
Prof. Andreas Wagner<br />
1 2<br />
3<br />
4<br />
42 °- Ost / ca. <strong>18</strong>0 m²<br />
- Ausnutzung unverschattete<br />
Morgensonne<br />
20°- West / ca. 140 m²<br />
- Maximierung Horizontal-/<br />
Westanteil 30 °- West / ca. 200 m²<br />
- Ausnutzung Abendsonne<br />
- flacher wegen höherem<br />
Horizont<br />
5 6<br />
Die <strong>Architektur</strong> der traditionellen Schwarzwaldhöfe<br />
nimmt großen Einfluss auf das vorhandene<br />
Landschaftsbild des Schwarzwaldes<br />
und ist ein identitätsspendendes Mekmal dieser<br />
Region. Alle Anforderungen an die damaligen<br />
Lebensbedingungen wurden in der <strong>Architektur</strong><br />
vorbildlich erfüllt und die Bauweise der<br />
Schwarzwaldhöfe steht in enger Verbindung<br />
mit den damaligen lokalen Gegebenheiten.<br />
Die Konversation zwischen architektonischer<br />
Typologie und den lokalen Gegebenheiten einer<br />
Region hat sich in den letzten Jahrzehnten jedoch<br />
geändert. Nahezu überall lässt sich eine<br />
Vereinheitlichung der <strong>Architektur</strong> feststellen,<br />
was zu einem Verlust des regionalen Profils<br />
führt.<br />
Durch eine Neuinterpretation der gewachsenen<br />
Struktur der Schwarzwaldhöfe und dem<br />
damit einhergehenden Umgang mit äußeren<br />
Einflüssen, lassen sich wichtige Erkenntnisse<br />
auf heutige Problemstellungen der <strong>Architektur</strong><br />
übertragen.<br />
Das Gebäude ist in drei Bereiche gegliedert die<br />
alle unter einem Dach vereint sind. Zum einen,<br />
bietet es Wohnraum <strong>für</strong> den Bauherren, zum<br />
anderen gibt es einen öffentlichen Bereich, der<br />
an die vorhandene kulturelle Achse des Dorfes<br />
anschließt, sich aber flexibel nutzen lässt. Der<br />
dritte Bereich dient als Unterkunft, die dem<br />
öffentlichen Bereich zugeordnet ist oder alternativ<br />
vermietet wird.<br />
Man bewegt sich von der ehemaligen Schutzfunktion<br />
gegenüber der Witterung zu einer<br />
Nutzungsfunktion der Witterung. Mögliche<br />
Solarenergienutzung, sowohl passiv als auch<br />
aktiv sind entscheidend in der Formfindung<br />
dieses Entwurfes. Das Gebäude ist komplett<br />
stromautark und lässt es zu, dass auch die umliegende<br />
Bebauung von der solaren Energiegewinnung<br />
profitieren kann.<br />
Ein weiterer wichtiger Teilaspekt des Entwurfes<br />
ist die Verwendung von regionalen Ressourcen<br />
und örtlicher Handwerkskunst, so können<br />
nahezu alle nötigen Baumaterialien in einem<br />
Umkreis von ca. 60 km bezogen werden.<br />
1) Lageplan<br />
2) Perspektive<br />
3) Grundriss EG<br />
4) Grundriss OG<br />
5) Schnitt<br />
6) aktive Solarenergienutzung
Public Station, Hamburg Altona<br />
Jerónimo Haug<br />
Fachgebiet Raum und Entwerfen<br />
Prof. Marc Frohn<br />
Fachgebiet <strong>Architektur</strong>theorie<br />
Prof. Georg Vrachliotis<br />
2<br />
3<br />
1<br />
4<br />
5<br />
6<br />
Unsere Gesellschaften sind von einer Mobilität<br />
in Ausmaß und Geschwindigkeit,<br />
historisch ungeahnter Dimension ergriffen.<br />
Alles ist unterwegs, Menschen, Waren, Daten,<br />
Müll. Menschen, auf dem Weg zur Arbeit,<br />
auf der Flucht, auf der Suche nach Glück, als<br />
Wirtschaftsflüchtling oder Tourist, Daten auf<br />
weltumspannenden Netzen, Mikroplastik im<br />
Kreislauf der Nahrungsketten, alles ist in Bewegung,<br />
in allen Lebensbereichen, die Aufzählung<br />
nahezu endlos fortsetzbar. In einer digitalisierten<br />
Welt verlieren Ort und Entfernung<br />
nicht nur zunehmend an Bedeutung, auch das<br />
öffentliche Leben verschiebt sich immer mehr<br />
in den virtuellen Raum. Während der öffentliche<br />
Raum einer Tendenz der Ökonomisierung<br />
und Privatisierung unterworfen ist, wird so<br />
viel privates öffentlich gemacht, wie nie zuvor.<br />
Das Verhältnis von Innen und Außen hat sich<br />
radikal gewandelt. Der Bahnhof, der einen<br />
großen Teil seiner Nutzungen längst verloren<br />
hat, wird neu programmiert. Der Entwurf<br />
sucht nach der Grenze zwischen öffentlichem<br />
und privatem Bereich, in dem er die Funktionen<br />
extremer Mobilität und temporären<br />
Wohnens miteinander kombiniert. Er bedient<br />
sich dabei dem Konzept des Monuments. Das<br />
Monument wird dabei als architektonischer<br />
Ausdruck einer Lebensweise, bedingt durch<br />
die sozialen, technischen, politischen und wirtschaftlichen<br />
Bedingungen seiner Zeit definiert.<br />
Die vernetzte Lebensweise unserer Zeit wird<br />
in einem öffentlichen Gebäude manifestiert<br />
und damit sichtbar gemacht. Die zwei Hochhausscheiben<br />
beherbergen die, von der Wohndauer<br />
her von unten nach oben steigenden und<br />
auf den Rückzug reduzierten Wohntypologien.<br />
Gleise und Bahnsteige verlaufen auf der Ebene<br />
des Obergeschosses. Ebenerdig überlagern<br />
sich der Bahnhofbereich, Stadtfunktionen und<br />
Bedürfnisse des Wohnens. Dieses Feld wird<br />
zum Verhandlungsraum in dem die Grenze<br />
von Innen und Außen von jedem neu und individuell<br />
ausgehandelt werden kann.<br />
1) Axonometrie<br />
2) Außenperspektive<br />
3) Feld<br />
4) Bahngleise<br />
5) Scheibe<br />
6) Grundriss Erdgeschoss
Bücherwelt, Frankfurt am Main<br />
Hannah Hollax<br />
Fachgebiet Baukonstruktion<br />
Prof. Ludwig Wappner<br />
Fachgebiet <strong>Architektur</strong>kommunikation<br />
Prof. Riklef Rambow<br />
1<br />
2<br />
3<br />
Frankfurts neue Bücherwelt befindet sich an<br />
prominenter Stelle: Zentral gelegen zwischen<br />
der Innen- und Altstadt. Die Nachbarschaft ist<br />
vielseitig und heterogen. Neben der Kleinmarkthalle<br />
gehört auch die historische Wohnbebauung<br />
im Tierischen Hof dazu.<br />
In Richtung Norden reiht sich das Gebäude<br />
städtebaulich in die bestehenden baulichen<br />
Achsen ein und bildet einen neuen Blickpunkt.<br />
Durch die Setzung von zwei Baukörpern, dem<br />
Bibliotheksgebäude sowie dem eingeschossigen<br />
Caféhaus im Süden entsteht zusammen<br />
mit der Kleinmarkthalle ein Ensemble, dass<br />
einen Platz ausbildet. Dieser Platz bietet allen<br />
Bürgern einen neuen öffentlichen Platz zum<br />
Verweilen.<br />
Die <strong>Master</strong>arbeit setzt sich mit der grundlegenden<br />
Frage auseinander, welche Zukunft<br />
Bibliotheken heute haben. Bibliotheken<br />
befinden sich in einer Zeit der Veränderung<br />
und entwickeln sich zu einem dritten Ort in<br />
der Gesellschaft.<br />
Sie müssen sich kontinuierlich verändern<br />
und flexibel nutzbare Flächen anbieten, neue<br />
Funktionen und Technologien schaffen und<br />
anbieten.<br />
Mit ihrer Vielzahl an Rollen erweitert die Bibliothek<br />
ständig ihren Beitrag zu einer vielfältigen<br />
Gesellschaft und wirkt damit ihrem Ruf<br />
als angeblich überholte Einrichtung entgegen.<br />
Heute und auch in der Zukunft wird es<br />
verstärkt darum gehen, dem Besucher diesen<br />
Ort zum Aufhalten im städtischen Kontext zu<br />
stellen, an dem er sein Verweilen individuell<br />
gestalten kann. Hierbei ist es zweitrangig,<br />
wie viele Bücher es in der Zukunft geben wird.<br />
Mit der neuen Bibliothek in Frankfurt am<br />
Main bekommen die Bürger Frankfurts ein<br />
neues Wohnzimmer in der Stadt: Einen öffentlichen<br />
Treffpunkt zum Verweilen, Erobern und<br />
Entdecken.<br />
1) Perspektive<br />
2) Perspektive Foyer<br />
3) Ansicht Süd
Bücherwelt, Frankfurt am Main<br />
Hannah Hollax<br />
Fachgebiet Baukonstruktion<br />
Prof. Ludwig Wappner<br />
Fachgebiet <strong>Architektur</strong>kommunikation<br />
Prof. Riklef Rambow<br />
Studierräume<br />
Lesesaal<br />
7. OBERGESCHOSS<br />
Studieren<br />
DACHTERRASSE<br />
Leselounge<br />
7.ELEMENT<br />
Wendeltreppe<br />
6. OBERGESCHOSS<br />
Sachbücher<br />
Lesesaal<br />
6. ELEMENT<br />
Abschluss<br />
5. OBERGESCHOSS<br />
Romane<br />
5. ELEMENT<br />
Sitzstufen<br />
Lesewohnzimmer<br />
4. ELEMENT<br />
Kinderrutsche<br />
Kinderland<br />
4. OBERGESCHOSS<br />
Kinder & Jugendbibliothek<br />
Working Space<br />
3.ELEMENT<br />
Lernkaskade<br />
3. OBERGESCHOSS<br />
Internationale Bibliothek<br />
Kulturbühne<br />
2. OBERGESCHOSS<br />
Musikbibliothek<br />
2.ELEMENT<br />
Tribüne<br />
Beginn Leseerlebnispfad<br />
Konferenzräume<br />
1. OBERGESCHOSS<br />
Bibliotheksverwaltung<br />
no public access area<br />
1. ELEMENT<br />
AUFTAKT<br />
Medienrückgabe<br />
Garderobe und Schließfächer<br />
Workshopfläche<br />
Information<br />
Kleiner Veranstaltungsraum<br />
ERDGESCHOSS<br />
UNTERGESCHOSS<br />
Zugang Untergeschoss<br />
IT, Technik,Magazin, Lager, Großer Veranstaltungsraum<br />
Browsing, Tagespresse und News<br />
1 2<br />
3<br />
4 5<br />
Das innenräumliche Konzept gleicht zwei zueinander<br />
verdrehten, gegenläufigen Spiralen.<br />
Im durchgesteckten Erdgeschoss wird der<br />
Besucher vom einer inszenierten Treppe, die<br />
den Auftakt des Leseerlebnispfades bildet<br />
abgeholt, über welche er direkt ins zweite<br />
Obergeschoss geführt wird. Die Treppe bietet<br />
auf den Podesten bereits erste Möglichkeiten<br />
zum Verweilen. Im zweiten Obergeschoss, in<br />
der Musikbibliothek, wird der Besucher an<br />
den Medien vorbeigeführt bis er in der ersten<br />
zweigeschossigen Kommunikations <strong>–</strong> und Interaktionszone<br />
landet, in der sich als Nutzung<br />
die Kulturbühne befindet und als Treppenelement<br />
die Tribüne, welche den Bühnenbereich<br />
mit Sitzmöglichkeiten erweitert. Von diesem<br />
Bereich bekommt der Besucher bereits einen<br />
visuellen Anreiz, indem er die darüberlegende<br />
zweigeschossige Interaktions <strong>–</strong> und Kommunikationszone<br />
sieht, jedoch über die Tribüne<br />
in entgegengesetzter Richtung ins nächste<br />
Stockwerk geführt wird, in dem die Medienfläche<br />
warten und er durch diese am Ende des<br />
Geschosses in der bereits gesehenen Kommunikationszone<br />
landet. Hier befindet sich der<br />
Workingspace mit der integrierten Lernkaskade,<br />
die sowohl auf der Treppe wie auch unter<br />
der Treppe Möglichkeiten zum Verweilen und<br />
arbeiten bietet. Über die Lernkaskade wird<br />
der Besucher in die Abteilung der Kinder- und<br />
Jugendbücher geführt, vorbei an den Medien<br />
landet er in der Kommunikationszone<br />
Kinderland mit der Kinderrutsche. Auch diese<br />
verfügt über Treppen, die den Besucher in das<br />
Stockwerk der Romane hinaufführt. Auch dort<br />
beschreitet er zuerst den Gang zwischen den<br />
Medien hindurch, bis er im großzügigen Lesewohnzimmer<br />
empfangen wird und hier vor<br />
die Wahl gestellt wird den Leseerlebnispfad<br />
fortzusetzen und über die Sitzstufen zu den<br />
Sachbüchern zu gelangen oder die Wiederholung<br />
des inszenierten Auftakttreppenelements<br />
mit integrierten Sitzplätze nzu wählen, von<br />
welchen das Geschehen sowohl im Lesewohnzimmer<br />
wie auch im Stadtkontext, wahrnehmen<br />
kann oder die Dachterrasse betritt.<br />
1) Axonometrie<br />
2) Perspektive<br />
3) Grundriss Erdgeschoss<br />
4) Grundriss 1. Obergeschoss<br />
5) Grundriss 2. Obergeschoss
...<br />
...<br />
...<br />
...<br />
...<br />
...<br />
...<br />
...<br />
...<br />
...<br />
...<br />
...<br />
...<br />
...<br />
...<br />
...<br />
...<br />
...<br />
...<br />
...<br />
...<br />
...<br />
Das Mosaik der Räume, Marseille<br />
Identitätsstiftende Räume <strong>für</strong> dich sich wandelnde, multikulturelle Gesellschaft Marseilles<br />
Charlotte Knab<br />
Internationaler Städtebau<br />
Prof. Dr. Barbara Engel<br />
<strong>Architektur</strong>theorie<br />
Prof. Dr. Georg Vrachliotis<br />
Bruch<br />
Brachen aktivieren<br />
Akteursspezifische Räume<br />
schaffen<br />
Projekte als Pflaster<br />
?<br />
Wege ergänzen<br />
Wege hierarchisieren<br />
Segregation<br />
1<br />
Verwebung<br />
Stadtebene<br />
Quartiersebene<br />
Ausdehnung<br />
3<br />
4<br />
5<br />
Mosaik der Räume<br />
Akteur<br />
Akteur<br />
Akteur<br />
Verschattet<br />
Überdacht<br />
Durchläufig<br />
Halboffen<br />
Geschützt<br />
Offen<br />
Getrennt<br />
Durchmischt<br />
geordnet<br />
Aktiv<br />
Aktiv<br />
Ruhig<br />
2<br />
6<br />
In der Arbeit geht es um die Wechselbeziehung<br />
zwischen den Akteuren, also den Nutzern und<br />
dem öffentlichen Raum. Dabei steht folgende<br />
Fragestellung im Vordergrund: Wie verändert<br />
sich Gesellschaft kulturell durch Zuwanderung,<br />
und welche räumlichen Voraussetzungen<br />
müssen öffentliche Räume aufweisen, um als<br />
Begegnungsstätte der neuen Akteure fungieren<br />
zu können?<br />
In der vorangestellten schriftlichen Ausarbeitung<br />
wurde festgestellt, dass der Raum sich<br />
zum einen durch das Handeln der Akteure<br />
bildet, zum anderen jedoch auch vorgegebene<br />
Güter innerhalb des Raums dieses Handeln<br />
beeinflussen können. Auch die Kultur der<br />
Akteure spielt dabei eine Rolle.<br />
Für den Entwurf ist es daher entscheidend zu<br />
wissen, wer die Akteure sind und wie sich ihre<br />
Lebensweisen definieren. Somit können im<br />
Anschluss identitätsstiftende Räume geplant<br />
werden.<br />
Im Entwurf geht es um die Stadt Marseille,<br />
eine der größten Städte Frankreichs.<br />
Nach einer ausführlichen Analyse wurde<br />
festgestellt, dass es einen Bruch zwischen den<br />
südlichen und den nördlichen Vierteln der<br />
Stadt gibt. Dieser Bruch spiegelt sich dabei<br />
nicht nur in der gesellschaftlichen Struktur,<br />
sondern auch in der städtischen Infrastruktur<br />
wieder.<br />
Ziel des Entwurfs ist es daher den Bruch innerhalb<br />
der Stadt zu schließen. Dies geschieht<br />
durch ein Mosaik der Räume.<br />
Das Mosaik besteht dabei aus identitätsspezifischen<br />
Räumen, die auf die Anforderungen<br />
der einzelnen Akteure eingehen. Zwischen<br />
den einzelnen Räumen entstehen Wegeverbindungen.<br />
Das Mosaik wird schließlich in zwei<br />
Ebenen unterteilt. Die Stadtebene beinhaltet<br />
dabei hauptsächlich Begegnungsorte, während<br />
man in der Quartiersebene vorwiegend Rückzugsorte<br />
findet.<br />
1) Analyse<br />
2) Ziel<br />
3) Leitplan<br />
4) Erläuterungen<br />
5) Verbindungen<br />
6) Akteurspezifische Räume
± 0,00<br />
± 0,00<br />
-4,50<br />
-3,00<br />
-1,50<br />
± 0,00<br />
Eberhardstraße<br />
Wohnen<br />
Büro<br />
Kantine<br />
Lager<br />
Supermarkt<br />
Parkgarage<br />
Designhalle<br />
Restaurant<br />
Büro<br />
Frühstücksraum<br />
Boarding House<br />
Bar/Club<br />
Hirschstraße<br />
Töpferstraße<br />
Einblick Ausblick Warenhaus, Stuttgart<br />
Christine Kohlmann<br />
Baukonstruktion<br />
Prof. Ludwig Wappner<br />
Stadtquartiersplanung<br />
Prof. Markus Neppl<br />
1<br />
2<br />
Steinstraße<br />
Steinstraße<br />
Hirschstraße<br />
3 4<br />
15<br />
Die Krise der Warenhäuser mit ihrem zunehmenden<br />
Rückzug aus unseren Städten stellt<br />
den Anstoßpunkt dar, um über die zukünftige<br />
Entwicklung des stationären Handels, aber<br />
vor allem um über eine Folgenutzung der<br />
Gebäude nachzudenken. Einst Kathedralen<br />
des Konsums, verloren sie in den 1970ern<br />
durch die Flächenmaximierung und eine<br />
gesichtslose <strong>Architektur</strong> ihre stil- und stadtbildprägende<br />
Wirkung. Eine Entwicklung, die<br />
am Entwurfsobjekt Galeria Kaufhof Stuttgart<br />
Eberhardstraße mit dem Abriss des früheren<br />
Mendelsohnbaus, einem Eiermannneubau<br />
und weiteren Umbauten deutlich wird. Die<br />
allgemeine Krise des Betriebtyps, die Lage in<br />
Stuttgart und der bauliche Zustand machen<br />
eine weitere Warenhausnutzung nicht<br />
möglich. Anhand der städtebaulichen Analyse<br />
entsteht mit dem Entwurf eine Mischnutzung<br />
aus Einzelhandels-, Büro-, Gastronomie- und<br />
Wohnflächen. Das Bestandsgebäude wird<br />
auf seine Grundgeometrie aus Stützenraster,<br />
Geschosshöhen und Fußabdruck reduziert.<br />
Durch die Terrassierung und das Einsetzen<br />
neuer Lufträume und Treppenhäuser wird das<br />
Gebäude neu gegliedert. Es ergeben sich unterschiedliche<br />
Treppenhäuser: ein repräsentatives,<br />
ein funktionales, ein nachbarschaftliches<br />
und ein urbanes. Letzteres greift als Rolltreppenhaus<br />
die frühere Nutzung des Gebäudes<br />
auf und bedient die öffentlichen Bereiche. Das<br />
Zentrum bildet ein Atrium mit einer Treppenterrasse,<br />
die die beiden Erdgeschosszonen verbindet.<br />
Die Rasterung der Fassade macht die<br />
Nutzungen nach Außen sichtbar. Öffentlichere<br />
Bereiche zeichnen sich durch große Fensterfronten<br />
ab, die Haupteingänge werden durch<br />
geschwungene Glasflächen markiert. Loggien<br />
mit markanten Fassadenmarkisen schaffen<br />
<strong>für</strong> das Wohnen private Außenräume. Der Entwurf<br />
gibt so einen Ausblick, wie das ehemalige<br />
Warenhaus nicht nur durch die Art seiner<br />
Nutzung, sondern auch durch die <strong>Architektur</strong><br />
wieder mit dem Ort verknüpft werden kann.<br />
1) Städtebaumodell<br />
2) <strong>Architektur</strong>modell<br />
3) Grundriss Erdgeschoss Eberhardstraße<br />
4) Schnitt quer<br />
5) Ansicht Eberhardstraße
Vectorworks Educational Version<br />
Vectorworks Educational Version<br />
Vectorworks Educational Version<br />
Vectorworks Educational Version<br />
Kunstdock<br />
Die Wiederentdeckung des Hafengeländes in Varna, Bulgarien<br />
Desislava Kostadinova<br />
Gebäudelehre<br />
Prof. Meinrad Morger<br />
Landschaftsarchitektur<br />
Prof. Henri Bava<br />
3<br />
4 5<br />
1<br />
6<br />
2<br />
Die Grundidee des Entwurfes liegt in der<br />
Wiederentdeckung des Hafengeländes und<br />
seiner Potentiale im innerstädtischen Kontext.<br />
Es grenzt unmittelbar an die Altstadt, an<br />
Hauptbahnhof und den großzügigen Meeresgarten.<br />
Aufgrund von seinem <strong>für</strong> die Öffentlichkeit<br />
geschlossenen Nutzungsprofil spielt<br />
das Hafengelände eine undefinierte Rolle im<br />
städtischen Kontext. Deshalb besteht hier die<br />
Möglichkeit, mittels neuer Funktionen das<br />
Gebiet zu aktivieren und ihm eine gemeinschafts-<br />
und identitätsstiftende Bedeutung zu<br />
verleihen.<br />
Das städtebauliche Konzept besteht in einer<br />
Zonierung des Grundstückes und Verflechtung<br />
der umliegenden Nutzungen im Entwurfsgebiet.<br />
Das wichtigste Element ist der mittig<br />
stehende Kulturkomplex, der als eine Erweiterung<br />
der Altstadt als Kulturort fungiert. Das<br />
Kulturzentrum gliedert sich in sechs Gebäude.<br />
Auf einer Länge von ca.350 m reihen sich fünf<br />
der Baukörper aneinander, ein Leuchtturm im<br />
Osten bildet die Erweiterung der Hafenpromenade<br />
in die Vertikale. Die unterschiedlichen<br />
Nutzungen, die sie beinhalten, bestimmen die<br />
Größe des jeweiligen Volumen. Die Gebäudehöhe<br />
leitet sich aus dem gezielten industriellen<br />
Erscheinungsbild und orientiert sich an<br />
den Bestandslagerhallen im Westen. Durch die<br />
Fragmentierung und die Positionierung der<br />
einzelnen Nutzungen zueinander öffnet sich<br />
der großzügige Park zum Meer hin. Gleichzeitig<br />
werden Außenräume im Zusammenhang<br />
mit der entsprechenden Gebäudenutzung<br />
definiert.<br />
Um die Gebäude in gewissem Maße mit der<br />
Umgebung verschmelzen zu lassen, werden<br />
sie mit einer Hülle versehen, die komplett verglast<br />
ist. Ein Aluminiumgewebe zwischen den<br />
Glasscheiben reflektiert die Umgebung und<br />
leistet Sonnenschutz in den Innenräumen.<br />
Die reflektierende Fassade ermöglicht, dass<br />
das Kulturzentrum und der Außenraum als<br />
Einheit wahrgenommen werden können.<br />
1) Grundriss<br />
2) Ansicht West + Ansicht Ost<br />
3) Perspektive Außen<br />
4) Perspektive Foyer Veranstaltungssaal<br />
5) Perspektive Museum<br />
6) Axonometrie Freiraumkonzept
Leitlinien <strong>für</strong> ein Quartier zwischen Tradition und Moderne,<br />
Dubai-City<br />
Helen Kropp<br />
Internationaler Städtebau<br />
Prof. Barbara Engel<br />
Nachhaltiges Bauen<br />
Prof. Dirk Hebel<br />
Identität<br />
entwickeln<br />
Verbesserung der<br />
Mobilität<br />
Vielfalt<br />
(aus)leben<br />
Nachhaltiges<br />
Bauen<br />
1 2<br />
Umgang mit<br />
dem Kontext<br />
Straßenzüge_<br />
Verbesserung des Mikroklimas und der Mobilität<br />
Moderne Art der Textilverschattung moderne Windturmanwendung<br />
3 4<br />
Im Anschluss an die wissenschaftliche Arbeit<br />
„Die Stadtgesellschaft in Dubai City <strong>–</strong> Leitlinien<br />
<strong>für</strong> ein Quartier zwischen Tradition und<br />
Moderne“ und den daraus entwickelten Leitlinien<br />
beschäftigt sich meine <strong>Master</strong>arbeit mit<br />
der direkten Planung eines Quartiers unter<br />
Beachtung der gewonnenen Erkenntnisse. Der<br />
Hauptfokus meines Entwurfs beschäftigt sich<br />
mit der Symbiose der kulturellen und modernen<br />
Aspekte <strong>für</strong> die Entwicklung eines zukunftsträchtigen<br />
Quartiers.<br />
In der Analyse des Gebiets auf verschiedenen<br />
Ebenen sind einige wichtige Punkte in Vorschein<br />
getreten, die bei der Planung beachtet<br />
werden müssen. Auf Grundlage der Auswertung<br />
von den verschiedenen Analysekarten<br />
wurden insgesamt sechs Ziele definiert. Zu diesen<br />
gehören unter anderem die Verbesserung<br />
des Mikroklimas, die Stärkung der West-Ostverbindung<br />
und auch die Stärkung der sozialen<br />
Interaktion. Diese Ziele werden auf unterschiedliche<br />
Art und Weise umgesetzt. So wird<br />
zum Einen die schon bestehende Creekpromenade<br />
weiter ausgebaut und attraktive Nutzungen<br />
an dessen Saum angesiedelt. Ein weiterer<br />
Punkt ist die Öffnung der Grünräume und die<br />
Verknüpfung derer mit der Promenade.<br />
Um dieses Konzept umzusetzen benötigt man<br />
verschiedenen Werkzeuge. Da viele der auftretenden<br />
Probleme allgemeingültig <strong>für</strong> Planungen<br />
in heißen Klimazonen sind, habe ich<br />
einen Werkzeugkasten entwickelt, der sich mit<br />
diesen beschäftigt und verschiedene Lösungen<br />
anbietet. Zu diesen Werkzeugen gehören der<br />
Umgang mit den Straßenzügen, die optimale<br />
Form, Ausrichtung und Nutzung der Gebäude.<br />
Ebenso zählt das Bauteil Dach explizit und die<br />
korrekte Anwendung von Materialien dazu.<br />
Das letzte Werkzeug beschäftigt sich mit der<br />
Energie und der dazugehörenden Verbrauchsminimierung.<br />
Darauf aufbauend wurde das<br />
Entwurfsgebiet beplant und die einzelnen<br />
Werkzeuge in verschiedener Kombination angewendet,<br />
um so auf die klimatischen Gegebenheiten<br />
einzugehen und die Tradition mit der<br />
Moderne zu verknüpfen.<br />
1) Lageplan<br />
2) Leitlinien aus der Thesis „Stadtgesellschaft in Dubai-City_<br />
Leitlinien <strong>für</strong> ein Quartier zwischen Tradition und Moderne“<br />
3) Auszug_Werkzeugkasten_Straßenzüge<br />
4) Vertiefungsbereich_Nachbarschaftsplätze
Agora Sto Pilio<br />
Zentrum <strong>für</strong> die Dorfbewohner Kala Neras<br />
Marc Lindenmeyer<br />
Nachhaltiges Bauen<br />
Prof. Dirk E. Hebel<br />
<strong>Architektur</strong>kommunikation<br />
Prof. Dr. Riklef Rambow<br />
2<br />
1<br />
3<br />
+6,4m<br />
+6,4m<br />
+6,4m<br />
+7m +7m<br />
Arbeitskammer<br />
+7m<br />
+7m<br />
+7m<br />
+5,4<br />
+5,4m<br />
+6,4m<br />
4<br />
5<br />
6 7 8<br />
Kala Nera ein Dorf in der vom Piliongebirge<br />
geprägten Region Magnisia mit der Hauptstadt<br />
Volos. Ein beliebter Ferienort und vor<br />
allem im Sommer steigen die Bewohnerzahlen<br />
von eigentlichen 500 auf 5000 Bewohner. Dieser<br />
saisonale Anstieg spiegelt sich im Ortsbild<br />
und auch der wirtschaftlichen Ausrichtung<br />
wieder. Somit steigt die Gefahr, dass bedingt<br />
durch die finanziell schlechte Lage und die<br />
damit einhergehende Verzweiflung, die touristische<br />
Zielsetzungen über gesellschaftliche<br />
Werte dominieren.<br />
Im Gegenzug zu den im Pilion sich befindenden<br />
Bergdörfern besitzt das Dorf keinen traditionellen<br />
Versammlungsplatz - eine ‚Agora‘.<br />
Einen Ort an dem sich die Bewohner zusammenfinden<br />
und den sozialen Austausch pflegen<br />
können. Im <strong>Winter</strong> verlassen viele Bewohner<br />
das Dorf und ziehen in die Großstadt Volos, da<br />
viele der Häuser auf die winterlichen, klimatischen<br />
Bedingungen nicht ausgelegt sind.<br />
In Folge dieser Tendenzen soll durch den<br />
Entwurf ein neuer Ort geschaffen werden, der<br />
in erster Linie dem Dorf Kala Nera dient, ihn<br />
repräsentiert und den Bewohnern eine neue<br />
Perspektive ermöglicht. Durch das Verankern<br />
wichtiger Strukturen in einem identitätsstiftenden<br />
Gebäude und dem davon geprägtem<br />
öffentlichen Raum, wird der Grundstein <strong>für</strong><br />
ein nachhaltiges, kulturelles, soziales und<br />
dadurch gemeinschaftliches Leben geschaffen.<br />
Im Erdgeschoss befinden sich wichtige öffentliche<br />
Nutzungen wie dem traditionellen<br />
Kafenion, einem Werkbereich, einem Mehrzweckraum<br />
und einem Marktbereich. Diese<br />
gehen in den Außenraum über und verschmelzen<br />
mit den verschiedenen Platzbereichen.<br />
In den Obergeschossen hingegen finden sich<br />
Wohnräume <strong>für</strong> ältere Menschen mit alternativen<br />
Wohnkonzepten wieder. Zusammen mit<br />
ehrenamtlich Tätigen soll dem Gebäude, das<br />
notwendige Leben eingehaucht werden, wodurch<br />
es ganztags und über das Jahr hinweg<br />
betrieben werden kann.<br />
1) Modellfoto Café<br />
2) Modellfoto Collage Marktplatz<br />
3) Modellfoto Collage Werkbereich<br />
4) Grundriss Erdgeschoss<br />
5) Längsschnitt<br />
6) 1:500 Umgebungsmodell<br />
7) 1:100 Übersichtsmodell<br />
8) 1:25 Detail-und Ausschnittsmodell
Wasser, das verbindet! Ein Tagungs- & Sportzentrum am<br />
Schauffele See, Wörth am Rhein<br />
Laura Müller<br />
Baukonstruktion<br />
Prof. Ludwig Wappner<br />
Stadtquartiersplanung<br />
Prof. Markus Neppl<br />
1<br />
3<br />
2<br />
„Wasser, das verbindet!“ bespielt das Gelände<br />
des ehemaligen Kieswerkes am Schauffele See<br />
in Wörth am Rhein mit neuen Sportanlagen<br />
und einem Tagungszentrum.<br />
Die Erschließung des Geländes erfolgt über<br />
die als Allee ausgebildete Straße im Norden.<br />
Von dort werden die einzelnen Sportflächen,<br />
wie das Stadion und die Fußball- und Tennisplätze,<br />
erschlossen. Gebäude mit ergänzenden<br />
Indoornutzungen spannen sich am Kopf der<br />
Sportflächen entlang der Straße auf. Zusätzlich<br />
gibt es einen Holzsteg, der quer durch das<br />
Gelände verläuft und direkt am Bahnhofsplatz<br />
anknüpft. Entlang des Steges spannen sich<br />
von Norden nach Süden verschiedene Plätze<br />
auf - ein Minigolfplatz, ein Festplatz inmitten<br />
des Hauptgebäudes, ein Basketballplatz und<br />
ein Platz mit Sportgeräten zur Benutzung <strong>für</strong><br />
jeden Besucher. Der Steg erstreckt sich über<br />
die Wasserkante hinaus als Liegeplattform<br />
mit Treppen ins Wasser.<br />
Das Hauptgebäude umfasst ein Tagungszentrum<br />
& Co-Working-Space, ein Spa, ein<br />
Jugend- & Kulturzentrum und ein Hotel.<br />
Entlang des Steges sind die öffentlichen<br />
Nutzungen wie der gemeinsam genutzte<br />
Gastronomiebereich angesiedelt. Das einstöckige,<br />
in Holzbauweise konstruierte Gebäude<br />
verschmilzt durch die verspiegelte Aluminiumfassade<br />
mit der umgebenden Landschaft.<br />
Ein von Andreaskreuzen gesäumter Umgang<br />
läd den Besucher ein das ganze Gebäude zu<br />
erkunden.<br />
Das neue Tagungs- und Sportzentrum am<br />
Schauffele See spricht durch sein vielfältiges<br />
Angebot mitten in der Natur nicht nur die<br />
unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen der<br />
Stadt an, sondern fungiert auch als Anziehungspunkt<br />
und stärkt somit die überregionale<br />
Bedeutung der Stadt Wörth am Rhein.<br />
1) Lageplan<br />
2) Modellfoto<br />
3) Modellfoto
GSEducationalVersion<br />
Maschinenraum<br />
Kesselhaus<br />
Lager<br />
Empfang Büros<br />
Büros<br />
Büros<br />
Büros<br />
Leergut<br />
Anlieferung<br />
Brauerei<br />
Anlieferung<br />
Areal<br />
Lager<br />
Lager<br />
Lager<br />
Besprechungsraum<br />
Besprechungsraum<br />
Rohstofflager<br />
Brauereimuseum Schützenberger<br />
Vollgut<br />
Meisterbüro<br />
Kühlhaus/ Lager<br />
Maischepfannen Würzepfannen Läuterbottiche Wirlpools<br />
Werkstätten<br />
Küche<br />
Multifunktionshub/ Besprechungsräume<br />
FABLab<br />
Info/ Empfang<br />
Abfüllung<br />
THE BREWERY - Highend Dining and Drinking<br />
Lager<br />
Cafe<br />
Waage<br />
Filterung<br />
Brauküche<br />
GSEducationalVersion<br />
Kühlhaus untergähriges Bier<br />
Umkleiden<br />
Empfang<br />
Manufaktur<br />
Manufaktur<br />
Manufaktur<br />
Manufaktur<br />
Manufaktur<br />
Manufaktur<br />
Kühlhaus obergähriges Bier<br />
Brauschulung<br />
GSEducationalVersion<br />
GSEducationalVersion<br />
Toiletten<br />
Küche<br />
Fitne studio<br />
Lager<br />
Küche<br />
PUB<br />
Restaurant<br />
Schlafraum<br />
Spielzeugschuppen<br />
Empfang<br />
Küche<br />
<strong>KIT</strong>A - Gruppe 1<br />
Schützenberger Areal<br />
Eine Handwerkerkooperative im städtischen Kontext<br />
Strasbourg<br />
Torsten Neuberger<br />
Baukonstruktion<br />
Prof. Ludwig Wappner<br />
Stadtquatiersplanung<br />
Prof. Markus Neppl<br />
3<br />
4<br />
5<br />
1<br />
6<br />
2<br />
7<br />
Der Entwurf behandelt das brachliegende Gelände<br />
der ehemaligen Brauerei Schützenberger<br />
in Schiltigheim, einem Vorort Straßburgs.<br />
Durch Nutzungsüberlagerung von handwerklichen,<br />
kulturellen und öffentlichen Nutzungen<br />
soll ein neuer Stadtbaustein entstehen. Dabei<br />
soll es sich nicht bei einer reinen Umnutzung<br />
des Bestandes bleiben, sondern eher als<br />
Erweiterung desselben verstanden werden.<br />
Öffentliche Funktionen machen das Areal und<br />
damit die Produktionsstätten den Bürgern<br />
zugänglich und erhöhen so die Akzeptanz<br />
innerhalb des Wohngebietes.<br />
Am hoch aufragenden Schornstein des alten<br />
Sudhauses im Süden des Areals wird ein<br />
neuer Auftakt <strong>für</strong> das Areal geschaffen. Von<br />
hier gelangt man durch das Emfangsgebäude<br />
in den zentralen Innenhof, von dem aus alle<br />
angrenzenden Gebäude zentral erschlossen<br />
werden.<br />
Linkerhand befinden sich frei zugängliche<br />
Werkstätten und eine Multifunktionshalle,<br />
rechterhand begrenzt den Hof ein L-förmiger<br />
Anbau an die alte Mälzerei, der mehrere<br />
Manufakturbetriebe beherbergt. Dieser bindet<br />
geschickt die bestehende Meistervilla und die<br />
alten Bürogebäude im Osten ein und bildet so<br />
die neue Innenhofsituation.<br />
Die zweigeschossigen Betriebsgebäude sind<br />
im Obergeschoss durch ein Büroband an der<br />
zum Hof gerichteten Seite untereinander verknüpft<br />
und werden durch einen Essens- und<br />
Aufenthaltsbereich, der ehemaligen Meistervilla<br />
vorgelagert, ergänzt.<br />
In dem zweigeschossigen Anbau am nördlichen<br />
Ende des Hofes befindet sich die neue<br />
Brauerei mit Produktionshalle, Anlieferung,<br />
Büroräumen, Seminarraum, und Restaurant<br />
mit Fokus auf Bierverkostung.<br />
Der neue Stadtbaustein steht <strong>für</strong> eine zeitgemäße<br />
aber auch zukunftsorientierte Lösung<br />
zur Nutzungsüberlagerung, Heterogenität und<br />
Flexibilität, eine <strong>Architektur</strong>, die nicht nur <strong>für</strong><br />
sich selbst steht, sondern sich eingliedert und<br />
Bestehendes weiterdenkt.<br />
1) Grundriss Erdgeschoss<br />
2) Modellfoto<br />
3) Perspektive<br />
4) Ansicht Südfassade<br />
5) Schnitt<br />
6) Schnitt<br />
7) Modellfoto
95°C<br />
MineralBad Cannstatt<br />
Baden in Kulturen, Stuttgart<br />
Julia-Katharina Ochmann<br />
Baukonstruktion<br />
Prof. Ludwig Wappner<br />
Stadtquartiersplanung<br />
Prof. Markus Neppl<br />
1<br />
2<br />
24°C<br />
C<br />
D<br />
<strong>18</strong>°C<br />
60°C<br />
16°C<br />
36°C<br />
A<br />
36°C<br />
30°C<br />
<strong>18</strong>°C<br />
Technik<br />
Technik<br />
Becken<br />
A<br />
B<br />
Lager<br />
B<br />
24°C<br />
Badehalle<br />
Lager<br />
Küche<br />
Duschen D<br />
Duschen H<br />
Umkleiden<br />
Foyer<br />
Café<br />
Bijoubereich<br />
3<br />
C<br />
D<br />
4<br />
Mehr als 43 Millionen Liter Mineralwasser<br />
sprudeln täglich aus Stuttgarts Böden. Damit<br />
liegt unter der Stadt, nach Budapest, das größte<br />
Mineralwasservorkommen Europas. Knapp<br />
mehr als die Hälfte des täglich entspringenden<br />
Quellwassers wird gefasst und in den drei<br />
Mineralbädern der Stadt: dem Leuze, dem<br />
Mineralbad Berg und dem MineralBad Cannstatt,<br />
sowie in 19 Trinkbrunnen Stuttgarts zur<br />
Verfügung gestellt.<br />
Nach dem Verfall des Badewesens im Mittelalter,<br />
der auch Stuttgart traf, begann mit der<br />
Epoche der Kurorte eine prägende Entwicklung<br />
<strong>für</strong> den gesamten Stadtraum.<br />
Die Entstehung von Kuranlagen und Kurhotels<br />
konzentrierte sich im Bereich der natürlichen<br />
Mineralwasserquellen im damaligen<br />
Cannstatt. Seit dem Beginn der Bädertradition<br />
wurde sowohl durch das im Krieg zerstörte<br />
und anschließend provisorisch wieder aufgebaute<br />
Volksbad, als auch durch den bestehenden<br />
Bau eines Gesundheitsbades, der noch nie<br />
dagewesene linke (nordwestliche) Flügel des<br />
Kursaals dargestellt.<br />
Diese Funktion des baulichen Gegengewichts<br />
wird sowohl durch die Positionierung, die äußere<br />
Form, als auch die Ausrichtung der Nutzungen<br />
im Inneren des Entwurfs aufgegriffen.<br />
Angelehnt an die Ausformung des hinter dem<br />
Kursaal befindlichen Brunnenhofs, setzt sich<br />
die Arbeit mit dem rückseitigen Hang des<br />
Kurparks fort. Das Gebäude bildet zusammen<br />
mit der ausformulierten Kante der Topografie<br />
einen Innenhof. Es entsteht ein geschützter<br />
Ort <strong>für</strong> den Außenbereich des Bades. Durch<br />
die Nutzung der Topografie als raumbildendes<br />
Element entstehen Räume die in den Hang<br />
gegraben scheinen, und Nischen die wie die<br />
Exedren der römischen Thermenanlagen<br />
besondere Nutzungen signalisieren. Eine<br />
Gliederung des Baukörpers in vier Teile lässt<br />
die unterschliedlichen Bereiche des Bades von<br />
außen ablesbar werden. Die fließende und leitende<br />
Eigenschaft der runden Form wird auch<br />
im Gebäudeinneren konzeptuell genutzt und<br />
führt zu einer selbstverständlichen Durchwegung<br />
der Raumfolgen.<br />
1) Modell<br />
2) Lageplan<br />
3) Grundriss EG<br />
4) Axonometrie
Blurred Site - Vertical Jetty, Garzweiler<br />
Maximiliane CA Ocker<br />
Konstruktive Entwurfsmethodik<br />
Prof. Renzo Vallebuona<br />
Raumgestaltung<br />
Prof. Marc Frohn<br />
1<br />
2<br />
3<br />
4<br />
Die Theorie zum Entwurf beschäftigt sich mit<br />
Orten, die von Menschen geformt und verlassen<br />
wurden, denn neben dem ganz natürlichen<br />
Aufleben und Absterben von Orten der Erde<br />
wird festgestellt, dass durch die Menschen<br />
ein künstliches Äquivalent entsteht. Eine Intervention<br />
an einem Exemplarischen ´Ort der<br />
Unschärfe`, soll einen Umgang mit der noch<br />
undefinierten Fläche aufzeigen, die ihr Beachtung<br />
schenkt, sie belebt, sie nutzbar macht<br />
und sie ´am Leben erhält`. Es wird einen<br />
Gegenthese zu der Behauptung aufgestellt,<br />
es gäbe keine Ausweichmöglichkeiten auf der<br />
überall dicht besiedelten Welt mehr.<br />
Wie kann der Erde und ihrer Bevölkerung<br />
ein Ausweg aus der Begrenzung geboten und<br />
wie können neue Orte genutzt werden, deren<br />
human-psychischer Bezug momentan eher<br />
am Rande oder außerhalb der Wahrnehmung<br />
liegt?<br />
Viele Orte haben in der Vergangenheit unter<br />
der Selbstüberschätzung der Menschheit<br />
gelitten und bisher war der Verlust oder Ausschluss<br />
von Orten weniger zweifelhaft, doch<br />
allmählich muss sich der Mensch bewusst<br />
werden, dass das Verbrauchen und Hinterlassen<br />
von Flächen ausweglos wird. Sie können<br />
einen Weg <strong>für</strong> ein neues Verständnis der<br />
Schönheit werden und mit einer neuen Haltung<br />
gegenüber des humanen Handelns und<br />
dem entstehen von ´Orten der Unschärfe` eine<br />
andere zukünftige Landschaft formen.<br />
Exemplarisch <strong>für</strong> den Umgang und die Rückführung<br />
beziehungsweise Neuausrichtung von<br />
´Orten der Unschärfe` wird der Entwurf im<br />
Tagebau Garzweiler verortet. Die ausgekohlte<br />
Landfläche wird zu einem neuartigen Biotop<br />
und die Abgrenzung der Geschichte wird<br />
durch eine Erdrampe geöffnet. Zeit, Fluktuation<br />
und Aneignung macht die vertikale<br />
Promenade, die auf der Rampe steht, zu einer<br />
Infrastruktur, die auf den völlig neuen Ort<br />
und seine Anforderungen reagieren kann.<br />
1) Der Blick in eine Welt mit Orten, die verschwommen und<br />
undeutlich geworden sind<br />
2) Flucht von vom Planet als einzige Möglichkeit neuen Raum<br />
und Energie zu gewinnen<br />
3) Orte der Unschärfe öffnen, erleben, verstehen<br />
4) Perspektive zum Entwurf
GSEducationalVersion<br />
GSEducationalVersion<br />
GSEducationalVersion<br />
MADE IN BERLIN, Ein neues Produktives Quartier <strong>für</strong> Berlin<br />
Svenja Sauer<br />
Fachgebiet Stadtquartiersplanung<br />
Prof. Markus Neppl<br />
Fachgebiet Landschaftsarchitektur<br />
Prof. Henri Bava<br />
LOKALE LEBENSMITTEL-<br />
PRODUKTION<br />
Mezeka Lebensmittelhandel<br />
MOBILITÄTS HUB<br />
AN DER AUTBAHN<br />
Karottenfeld<br />
Himbeerfeld<br />
Erdbeerfeld<br />
Kartoffelfeld<br />
Kräutergarten<br />
Weiterleitung zu den Sitzstufen<br />
Schnittblumen<br />
Gemeinschaftsgarten<br />
LOCAL FOOD<br />
PRODUCTION<br />
Allee<br />
KLEINER HOF<br />
KASTANIENHOF<br />
KUNSTHOF<br />
Gassenraum<br />
GEWERBEHOF<br />
Shared space<br />
KREATIVHOF<br />
Durchgang unter der Autobahn<br />
Verbindung zum Tempelhofer<br />
Feld<br />
Grünwall entlang der Autobahn<br />
weniger Verkehr<br />
Austausch<br />
Integration<br />
soziale Mischung<br />
Beratung<br />
Werbung<br />
business support<br />
Homepage<br />
BÜRO<br />
Vermarktung Image<br />
Kurse / Austausch<br />
Networking<br />
lokale Kreisläufe<br />
WOHNEN<br />
homeoffice<br />
INDUSTRIE<br />
FORSCHUNG<br />
Verkauf<br />
neue Produkte<br />
BILDUNG<br />
Produktive<br />
Stadt<br />
Workshops<br />
NACHBARSCHAFTS-<br />
RAUM<br />
GEWERBE<br />
neue Herstellungsmethoden<br />
Stadt der kurzen Wege<br />
FAB LAB<br />
KULTUR /<br />
FREIZEIT<br />
Workshops<br />
Nachbarschaftsbelebung<br />
HANDWERK<br />
KÜNSTLER<br />
Bühnenbau<br />
kurze Wege<br />
Werkzeugverleih<br />
Individuelle Anfertigung<br />
Kollaborationen<br />
Kurse<br />
Kooperationen<br />
Start Ups<br />
Ausbildung<br />
Synergien<br />
Recycling<br />
lokale Wertschöpfung<br />
Blickbezüge zum Teltowkanal Weiterleitung zum Hafen Kooperationen<br />
WERKHOF<br />
SPORT AUF<br />
DEM BESTAND<br />
Autobahnanschluss A100<br />
BERLINER MISCHUNG<br />
IM BLOCK<br />
zwischen Werkhöfen<br />
1 2<br />
BAUGRUPPE<br />
GEMEINSCHAFTSRAUM<br />
SHARED SPACE<br />
DACHGARTEN<br />
DESIGNAGENTUR<br />
FAB LAB<br />
DENKER UND MACHER<br />
IM AUSTAUSCH<br />
MARKTHALLE<br />
SAROTTI SCHOKOLADEN FABRIK<br />
HAFEN MIT BOOTSANLEGER<br />
SAROTTI - SCHLOT<br />
KULTUR IN DER RÖSTEREI<br />
BRAUEREI + CLUB<br />
GRÜNTRASSE EISENBAHNBRÜCKE<br />
AUTOBAHN A100<br />
sarotti LAB<br />
Dachgarten<br />
Dachgarten<br />
Baugruppe<br />
Quartiersraum<br />
FAB LAB<br />
Markthalle<br />
Disco<br />
Büro Co-Working<br />
WG<br />
Wohnen<br />
Radshop<br />
GEMEINSCHAFTSGARTEN<br />
WERKHOF GEMEINSCHAFTSHOF TEILESTRASSE<br />
TIEFGARAGE WOHNEN UND ARBEITEN<br />
PROMENADE<br />
KANALWEG<br />
BERLINER BLOCKSTRUKTUREN<br />
VERTIKALE MISCHUNG<br />
TELTOWKANAL<br />
3<br />
4 5<br />
Aktuell werden unsere Städte immer mehr<br />
reduziert auf Gebiete mit monofunktionalem<br />
Wohnen, Konsum und Dienstleistungsflächen.<br />
Trotz aller Zielsetzungen zu mehr Nutzungsmsichung<br />
führen die meisten Planungen zu<br />
einer einseitigen Orientierung.<br />
Meine <strong>Master</strong>arbeit setzt hier an und zeigt an<br />
einem Beispiel in Berlin, wie die Reintegration<br />
einer urbanen Wertschöpfung einen bedeutenden<br />
Lösungsansatz <strong>für</strong> städtebauliche<br />
Entwicklungen darstellen kann.<br />
Vier typologisch unterschiedliche Gebiete<br />
geben eine Antwort darauf, inwieweit Wohnen,<br />
Gewerbe und Industrie zwischen dem Tempelhofer<br />
Feld und dem Teltowkanal in Berlin<br />
zukünftig zusammenfinden können.<br />
Jedes Gebiet reagiert dabei individuell auf die<br />
Umgebung und bietet Platz <strong>für</strong> unterschiedliche<br />
Arten von Produktion. Durch die Lage zwischen<br />
Feld und Kanal ist auch der Anschluss<br />
an den Naturraum und die Belebung der<br />
öffentlichen Räume eine wichtige Konsequenz.<br />
Zwischen den einzelnen Gebieten entstehen<br />
Kooperationen und Synergien zwischen Wohnen<br />
und <strong>Arbeiten</strong>. Der Naturraum fungiert als<br />
verbindendes Element.<br />
Durch eine neue Haltestelle an der Ringbahn,<br />
die Wiederbelebung von stillgelegten Gleisen<br />
als „Grüntrasse“ und den Anschluss an die<br />
Wasserwege, wird das Gebiet im großen Maßstab<br />
in die Stadt Berlin eingegliedert.<br />
Anschließend werden neue Arten von Arbeit<br />
und Produktion integriert und die Entwicklung<br />
als Wohnstandort vorangetrieben.<br />
Innovation und Bildung sind treibende Kräfte<br />
der Zukunftswirtschaft. Die Büros in der<br />
Skyline am Feld treten in Austausch mit<br />
Forschung, Entwicklung und Industrie der<br />
Großstrukturen und dem Campus.<br />
In den Berliner Blockstrukturen finden unterschiedliche<br />
Wohnmodelle und eine kleinteilige<br />
Produktion in den Höfen statt.<br />
Am Teltowkanal entstehen neue vertikale<br />
gemischte Strukturen und öffentliche Plätze.<br />
Gemeinschaftliche Räume fördern Integration,<br />
Austausch und Weiterbildung.<br />
1) Axonometrie „Berliner Mischung“<br />
2) Konzeptgrafik Produktive Stadt<br />
3) Schnitt durch Blöcke und Teltowkanal<br />
4) Modell 1:1000<br />
5) Perspektive Grüntrasse
GSEducationalVersion<br />
Te rasse<br />
Labor<br />
GSEducationalVersion<br />
Zugang<br />
Winzerwohnung<br />
Ba rique-<br />
Lager<br />
Tanklager<br />
Tanklager<br />
Tre pe zum<br />
Ke ler<br />
Tre pe zum<br />
Innenhof<br />
Tre pe zur<br />
Wohnung<br />
Zugang<br />
Ferienwohnung<br />
B<br />
Zugang<br />
Lagerfläche<br />
Galerie<br />
Loggia<br />
Zugang<br />
Vinothek,<br />
Küche<br />
Zugang<br />
Vinothek<br />
Treppe zur<br />
Lagerfläche<br />
Weinstand<br />
Sitzgarnituren<br />
Mü ltonnen<br />
Vorräte<br />
Weinkultur trifft Baukultur<br />
Neugestaltung eines Weinguts im urbanen Kontext<br />
Julia Schäfer<br />
Fachgebiet Gebäudelehre<br />
Prof. Meinrad Morger<br />
Fachgebiet Baukonstruktion<br />
Prof. Ludwig Wappner<br />
leere Gitterboxen<br />
Labor<br />
5 qm<br />
Heizung / Technik<br />
12 qm<br />
Waschmaschine<br />
Etikettiermaschine<br />
Palette mit<br />
Kartons<br />
Aufbereitung<br />
65 qm<br />
Regal mit Etiketten Waschzubehör<br />
Tanklager<br />
Flaschenlager<br />
mit Kundenerlebnis<br />
vo le Gitterboxen<br />
52 qm<br />
Hebebühne<br />
6 qm<br />
Treppe zum<br />
Ke ler<br />
Innenhof<br />
Wohnung<br />
Verkaufslager<br />
29 qm<br />
Loggia<br />
11 qm<br />
Küche<br />
13 qm<br />
Küche<br />
WC Damen<br />
5 qm<br />
WC<br />
WC Herren<br />
5 qm<br />
Vinothek<br />
57 qm<br />
1<br />
2<br />
4<br />
3<br />
5<br />
Weinkultur trifft Baukultur - dies zeigt sich<br />
gegenwärtig anhand vieler renommierter<br />
Projekte. Auch das in Familienhand geführte<br />
Weingut Schäfer im Rheingau soll durch eine<br />
Transformation zukunftsfähig werden. Die<br />
genaue Analyse und Bewertung der Bestandspläne,<br />
einhergehend mit der Entwicklung eines<br />
neuen Raumprogramms und der Formulierung<br />
von Entwurfszielen, bildet die Grundlage<br />
<strong>für</strong> den Entwurf. Das Konzept sieht eine<br />
konsequente Nutzungsänderung vor. Zukünftig<br />
wenden sich die repräsentativen Flächen der<br />
Stadt zu. Gleichzeitig hat der Kunde die Möglichkeit<br />
den Prozess der Entstehung seines<br />
Produkts vor Ort zu erleben. Auch das Wohnen<br />
findet mittels einer neuen Erschließungszone<br />
auf Ebene 1 als Rückzugsort einen neuen Platz<br />
im Gefüge. Das Weingut als typologischer<br />
Hybrid beherbergt viele Funktionen, die<br />
ineinander greifen und dennoch einzelne<br />
Bereiche ausbilden. Das Herzstück des Entwurfs<br />
ist der rückwärtige Weinspeicher. Hier<br />
findet einerseits die sinnvolle Kopplung der<br />
Produktionsschritte statt, andererseits dient<br />
er auch als Ort der Inszenierung. Über ein<br />
umlaufendes Kundenband und einen großzügigen<br />
Luftraum kann der Besucher dem<br />
Schauspiel des Weinmachens mit Blick auf<br />
die großen Edelstahltanks beiwohnen. Über<br />
eine einschneidende Fuge werden die neuen<br />
Baukörper bis hinunter in den Weinkeller<br />
belichtet, so dass ein in sich geschlossenes<br />
Ensemble mit introvertiertem, fast autarkem<br />
Charakter entsteht.<br />
Konstruktiv nimmt der neue Weinspeicher<br />
durch seine in beigem Sichtbeton mit horizontaler<br />
Schalungsstruktur ausgeführte Fassade<br />
Bezug zur Ziegelfassade des Bestands auf. Die<br />
raumhaltigen Mauern zur Grundstücksgrenze<br />
werden mittels eines Gründachs neu interpretiert<br />
und schaffen im Inneren einen dem Wein<br />
zuträglichen sommerlichen Wärmeschutz. Alle<br />
Brüstungen sind als Holzlamellen ausgeführt<br />
und erzeugen ein homogeneres Erscheinungsbild<br />
der Gesamtstruktur.<br />
1) Perspektive Innenhof<br />
2) Grundriss Erdgeschoss<br />
3) Lageplan<br />
4) Längsschnitt<br />
5) Modell 1:100
SHARE! Nachverdichtung durch Nutzung bestehender<br />
Strukturen // <strong>Architektur</strong> der Gemeinschaft, Karlsruhe<br />
Elizabeth Victoria Scherzer<br />
Nachhaltiges Bauen<br />
Prof. Dirk Hebel<br />
<strong>Architektur</strong>theorie<br />
Prof. Dr. Georg Vrachliotis<br />
1<br />
2<br />
3 4<br />
SHARE! basiert auf dem Gedanken Flächen<br />
effizienter zu nutzen <strong>–</strong> sie zu Teilen.<br />
Bestehende Strukturen werden untersucht<br />
und eine Doppelnutzung in Frage gestellt.<br />
Wohnflächen sollen minimiert und ein größtmöglicher<br />
Gesamtnutzen erzeugt werden.<br />
Konkret wird ein Supermarktparkplatz überbaut.<br />
Über der versiegelten Fläche wird eine<br />
zweite Baufläche auf 4m Höhe eingezogen,<br />
bestehende Funktionen bleiben. Die L-förmige<br />
Bebauung belegt die neue Baufläche ideal: der<br />
Baukörper schließt die Baulücke und gliedert<br />
sich an die fensterlose Fassade des Supermarktlagers.<br />
Durch ein Rohr wird man vom<br />
Straßenraum in eine neue Welt gesaugt - frei<br />
von Autos. Dieser Hof bildet einen Treffpunkt<br />
<strong>für</strong> Bewohner und Nachbarn.<br />
Nutzungen wie ein Café, Ateliers und Werkstätten<br />
haben hier Platz. Außerdem befinden<br />
sich hier die Wohnungszugänge. Eine Lobby<br />
und Bibliothek laden Bewohner und Gäste<br />
ein. Ein Raum ist flexibel nutzbar, tagsüber<br />
als Kinderhort, abends zum gemeinsamen<br />
Kochen.<br />
Das Wohnprogramm reicht von Clusterwohnungen<br />
<strong>für</strong> Singles, über Wohngemeinschaften<br />
und Pärchenwohnungen. Außerdem gibt es<br />
den Wohntyp Familie+ und Senior+. Familie+<br />
zeichnet sich durch ein zuschaltbares Zimmer<br />
aus. Senior+ durch eine angelagerte Wohnung,<br />
die eine Pflegekraft oder den Enkel beherbergen<br />
kann. Alle Wohntypen sind so konzipiert,<br />
dass der Flächenverbrauch pro Person minimiert<br />
ist. Verglichen mit dem durchschnittlichen<br />
dt. Flächenverbrauch von 40m² liegt er<br />
hier mit 24m² pro Person deutlich darunter.<br />
Die schönsten Orte sind der Gemeinschaft zugeschrieben.<br />
Der öffentliche Hof und das Dach,<br />
welche über Sitzstufen verbunden sind. Das<br />
Dach ist der Treffpunkt, den sich jedes Haus<br />
wünscht. Ein Dachgarten mit Sauna und Pool.<br />
Besonders jetzt, im Zeitalter der Digitalisierung,<br />
würde es vielen Menschen gut tun, Teil<br />
eines realen sozialen Netzwerks zu sein.<br />
1) Perspektive Straße<br />
2) Grundrisse<br />
3) Modellfoto Hof<br />
4) Modellfoto Lage
MUSIK VERBINDET - Neues Wohn- und Musikkonzept<br />
<strong>für</strong> die Musikhochschule Freiburg<br />
Janine Schwarzkopf<br />
Nachhaltiges Bauen<br />
Prof. Dirk Hebel<br />
Internationaler Städtebau<br />
Prof. Dr.-Ing. Barbara Engel<br />
C-C<br />
C-C<br />
C-C<br />
B-B<br />
B-B<br />
B-B<br />
1<br />
A-A<br />
2<br />
A-A<br />
3<br />
A-A<br />
1<br />
4 5<br />
35<br />
6<br />
7<br />
8<br />
Das Ganter-Areal in Freiburg soll um eine<br />
gemeinschaftliche Nutzung, sowie um bezahlbaren<br />
Wohnraum erweitert werden. Für die<br />
gemeinschaftliche Nutzung bietet sich eine<br />
Musiknutzung an, da die Musikhochschule<br />
nur wenige Gehminuten entfernt ist und in<br />
Freiburg ein vielfältiges kulturelles Programm<br />
gewünscht wird. Zudem verbindet Musik unterschiedliche<br />
Generationen, sowie Alters- und<br />
Gesellschaftsschichten und bietet eine gute<br />
Ausgangslage um einen Ort des Austausches<br />
und der Durchmischung zu schaffen. Das Areal<br />
soll wichtige Bestandsgebäude behalten und<br />
um einen markanten Neubau, der im Kontrast<br />
zu den alten Produktions- und Lagergebäuden<br />
steht, vervollständigt werden. Ein öffentlicher<br />
Grünraum soll sowohl am Flußufer, als auch<br />
auf den großen Dachflächen des Neubaus<br />
geboten werden, sodass Anwohner von öffentlichen<br />
Grünflächen in der Stadt profitieren<br />
können. Eine unterschiedliche Bespielung<br />
sorgt hierbei <strong>für</strong> unterschiedliche Öffentlichkeitsgrade.<br />
Die Stadt und Ihre Bewohner<br />
sollen in das neue Gebäude gezogen werden.<br />
Dazu werden unterschiedliche Einblicke in<br />
die öffentlichen Nutzungen generiert. Diese<br />
sollen das Interesse wecken und neugierig auf<br />
den Austausch mit anderen machen. Ebenso<br />
werden im Erdgeschoss Angebote im Sinne<br />
der Vernetzung der Nachbarschaft geschaffen.<br />
Das Hauptaugenmerk liegt allerdings auf der<br />
Musiknutzung, welche als verbindende Ebene<br />
ihren Platz im ersten Obergeschoss findet.<br />
Diese soll alle Gruppen ansprechen und mit öffentlichen<br />
Angeboten als Kommunikationsebene,<br />
die sowohl Platz <strong>für</strong> Gruppenaktivitäten<br />
bietet, als auch zur privaten Nutzung einläd,<br />
dienen. Über der öffentlichen Plattform finden<br />
vier Wohntürme ihren Platz. Diese dienen sowohl<br />
den Studierenden der Musikhochschule,<br />
als auch Familien oder Alleinstehenden jeder<br />
Altersgruppe. Durch offene Grundrisse und<br />
unterschiedliche Wohnungsgrößen sollen sie<br />
jeden Ansprechen.<br />
1) Grundriss Erdgeschoss<br />
2) Grundriss 1. Obergeschoss<br />
3) Grundriss 2. Obergeschoss<br />
4) Ansicht Süd<br />
5) Schnitt A-A<br />
6) Modellfoto 1:1000<br />
7) Modellfoto 1:200<br />
8) Perspektive Grünraum
Interreligiöses Zentrum, München<br />
Lucy Sommavilla<br />
Baukonstruktion<br />
Prof. Ludwig Wappner<br />
<strong>Architektur</strong>kommunikation<br />
Prof. Dr. phil. nat. Riklef Rambow<br />
1 2<br />
3 4<br />
Der aktuelle Diskurs zeigt, dass heutzutage<br />
unterschiedliche Religions- und Kulturzugehörigkeit<br />
als ein Problem <strong>für</strong> das friedliche<br />
Zusammenleben angesehen wird. Welchen<br />
Beitrag kann die <strong>Architektur</strong> leisten, damit<br />
Menschen unserer multikulturellen Gesellschaft<br />
miteinander in Kontakt kommen<br />
können?<br />
Das interreligiöse Zentrum positioniert sich<br />
am südöstlichen Ende des Finanzgartens in<br />
München. Es besteht aus den drei Bethäusern<br />
der abrahamitischen Religionen und einem<br />
weiteren vierten Baukörper. Diese sind als Ensemble<br />
ausbalanciert und zu einer Gesamtheit<br />
zusammengeschaltet. Der Entwurf steht <strong>für</strong><br />
die Eigenständigkeit der Religionen durch das<br />
Bereitstellen von drei separaten Bethäusern,<br />
als auch <strong>für</strong> deren Miteinander durch die verbindende<br />
städtebauliche Setzung der Gebäude<br />
zueinander. Die aufgelöste Typologie antwortet<br />
auf den besonderen naturnahen Ort.<br />
Zuwegung und innere Erschließung sind leitende<br />
Motive des Entwurfs. Über den offenen<br />
Straßenraum und die Parkanlagen gelangt<br />
der Besucher in die Verengung zwischen den<br />
Gebäuden. Diese bilden eine Art Fuge, in welche<br />
der öffentliche Stadtraum hineingezogen<br />
wird. Arkaden und Bodengänge funktionieren<br />
als räumlicher Filter und Schwellenraum und<br />
prägen die Zwischenräume atmosphärisch und<br />
strukturell. Die Erschließung der Sakralräume<br />
ist durch den mittleren Baukörper<br />
gegeben, der zur gemeinsamen Wegekreuzung<br />
und zum Ort der Begegnung wird. Die Sakralräume<br />
sind als eine Folge ihrer geschlossenen<br />
Fassaden introvertiert geplant. Die Erzeugung<br />
einer sakralen Atmosphäre entsteht durch<br />
ein Raum-in-Raum Prinzip. Am Beispiel der<br />
Moschee fällt durch eine Aussparung zenital<br />
Licht in den inversen Kuppelraum ein, so dass<br />
ein großer Kontrast von Licht und Schatten<br />
erfahrbar ist. Während es außerhalb des Kuppelraumes<br />
zu einem anderen Dialog zwischen<br />
Materialität und Licht kommt, da sich die<br />
filigrane Stahlkonstruktion des transluzenten<br />
Glasdaches im Licht aufzulösen scheint.<br />
1) Lageplan<br />
2) Innenraumeindruck Synagoge<br />
3) Grundriss 1.OG (Sakralräume)<br />
4) Ansichten und Schnitte
Stadt - Land Hybrid, China<br />
Zhizhong Wang<br />
Nachhaltiges Bauen<br />
Prof. Dirk Hebel<br />
Bildende Kunst<br />
Prof. Stephen Craig<br />
1<br />
3<br />
2<br />
In den letzten 30 Jahren gibt es über hunderd<br />
Millionen Menschen in China, die aus dem<br />
ländlichen Gebiet in die Stadt eingewandert<br />
haben. Dabei kommt es zum großen Stoß von<br />
der Kultur, der Gesellschaft und dem Leben.<br />
Ich möchte in meinem Entwurf untersuchen,<br />
wie die ländliche Kultur mit den lokalen<br />
Elementen in der Stadt überlagern und weiter<br />
entwickeln kann.<br />
Das Problem in China ist die hohe Konsume<br />
und Verschwendung an Resourccen. Z.B die<br />
Konsume an Beton von 2011 bis 2013 in China<br />
ist 6.4 Milliarde Tonnen und 45% mehr als die<br />
in den USA in den letzten 100 Jahren. Gleichzeitig<br />
werden jedes Jahr in China über 700<br />
Millionen Tonnen Stroh produziert und ein<br />
Viertel sind lokal einfach direkt auf dem Land<br />
zu verbrennen. Die Resourccen sollten nicht<br />
unbegrenzt verbraucht. Deswegen möchte ich<br />
eine materielle konstruktive Lösung untersuchen.<br />
Das Gebäude ist hier mit Hybridkonstruktion<br />
(Holz, Beton, Stroh, Lehm) gebaut. Deswegen<br />
ist es als ein nachhaltiges passives Gebäude<br />
mit Low Technik ein guter Beginn in China.<br />
Nachdem gibt es hier in diesem Gebäude<br />
Hybridfunkionen. Im Erdgeschoss gibt es 2<br />
Ladens, 1 Arbeitsbereich, 1 Cafe und 2 Foyer.<br />
In den Obergeschossen gibt es Familienwohnungen<br />
und Arbeitsbereich.<br />
Das Gebäude ist mit ländlichen Elementen<br />
und städtischen Elementen sehr gut konbiniert.<br />
Es zeigt, wie das Gebäude in China in<br />
der Zukunft in der Stadt weiter entwickelt<br />
und dabei wie wir unsere Kultur und unsere<br />
Gewohnheiten bleiben können.<br />
1) Rendering<br />
2) Schnitte<br />
3) Grundriss EG
Impressum<br />
Diese Publikation versammelt alle von den Absolventinnen und Absolventen<br />
<strong>für</strong> die Veröffentlichung eingereichten <strong>Arbeiten</strong>. Die Beiträge wurden von<br />
den Absolventinnen und Absolventen erstellt. Die Rechte liegen bei ihnen.<br />
Gestaltung<br />
Dipl.-Des. Frank Metzger<br />
Bildnachweis<br />
Umschlag-Vorderseite:<br />
Public Station, Hamburg Altona<br />
Jerónimo Haug<br />
Umschlag-Rückseite:<br />
Stadt-Land-Hybrid, China<br />
Zhizhong Wang<br />
Herausgeberin<br />
<strong>KIT</strong>-<strong>Fakultät</strong> <strong>für</strong> <strong>Architektur</strong><br />
Englerstraße 7<br />
76131 Karlsruhe<br />
arch.kit.edu<br />
Karlsruhe, Mai 20<strong>18</strong>