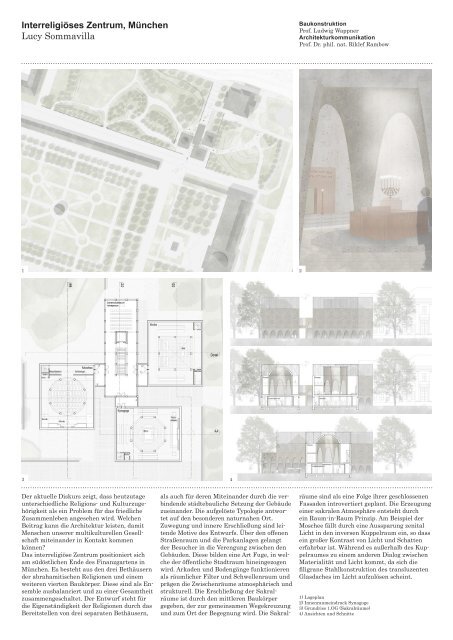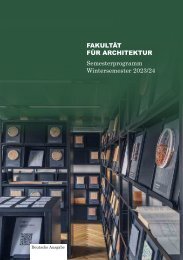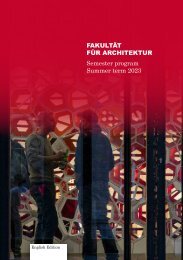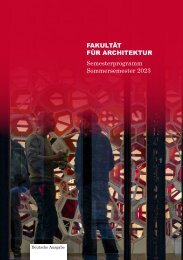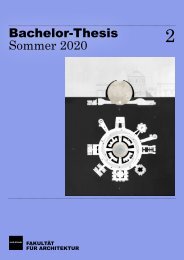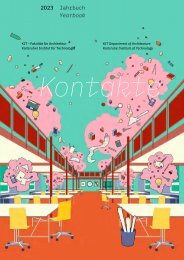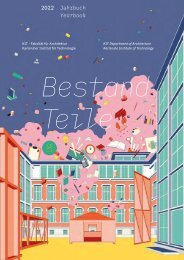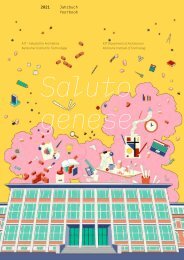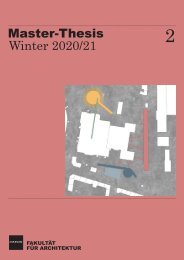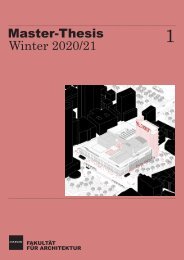KIT-Fakultät für Architektur – Master-Arbeiten Winter 2017/18
Dokumentation von Masterabschlussarbeiten des Wintersemesters 2017/18 an der Fakultät für Architektur am Karlsruher Institut für Technologie.
Dokumentation von Masterabschlussarbeiten des Wintersemesters 2017/18 an der Fakultät für Architektur am Karlsruher Institut für Technologie.
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Interreligiöses Zentrum, München<br />
Lucy Sommavilla<br />
Baukonstruktion<br />
Prof. Ludwig Wappner<br />
<strong>Architektur</strong>kommunikation<br />
Prof. Dr. phil. nat. Riklef Rambow<br />
1 2<br />
3 4<br />
Der aktuelle Diskurs zeigt, dass heutzutage<br />
unterschiedliche Religions- und Kulturzugehörigkeit<br />
als ein Problem <strong>für</strong> das friedliche<br />
Zusammenleben angesehen wird. Welchen<br />
Beitrag kann die <strong>Architektur</strong> leisten, damit<br />
Menschen unserer multikulturellen Gesellschaft<br />
miteinander in Kontakt kommen<br />
können?<br />
Das interreligiöse Zentrum positioniert sich<br />
am südöstlichen Ende des Finanzgartens in<br />
München. Es besteht aus den drei Bethäusern<br />
der abrahamitischen Religionen und einem<br />
weiteren vierten Baukörper. Diese sind als Ensemble<br />
ausbalanciert und zu einer Gesamtheit<br />
zusammengeschaltet. Der Entwurf steht <strong>für</strong><br />
die Eigenständigkeit der Religionen durch das<br />
Bereitstellen von drei separaten Bethäusern,<br />
als auch <strong>für</strong> deren Miteinander durch die verbindende<br />
städtebauliche Setzung der Gebäude<br />
zueinander. Die aufgelöste Typologie antwortet<br />
auf den besonderen naturnahen Ort.<br />
Zuwegung und innere Erschließung sind leitende<br />
Motive des Entwurfs. Über den offenen<br />
Straßenraum und die Parkanlagen gelangt<br />
der Besucher in die Verengung zwischen den<br />
Gebäuden. Diese bilden eine Art Fuge, in welche<br />
der öffentliche Stadtraum hineingezogen<br />
wird. Arkaden und Bodengänge funktionieren<br />
als räumlicher Filter und Schwellenraum und<br />
prägen die Zwischenräume atmosphärisch und<br />
strukturell. Die Erschließung der Sakralräume<br />
ist durch den mittleren Baukörper<br />
gegeben, der zur gemeinsamen Wegekreuzung<br />
und zum Ort der Begegnung wird. Die Sakralräume<br />
sind als eine Folge ihrer geschlossenen<br />
Fassaden introvertiert geplant. Die Erzeugung<br />
einer sakralen Atmosphäre entsteht durch<br />
ein Raum-in-Raum Prinzip. Am Beispiel der<br />
Moschee fällt durch eine Aussparung zenital<br />
Licht in den inversen Kuppelraum ein, so dass<br />
ein großer Kontrast von Licht und Schatten<br />
erfahrbar ist. Während es außerhalb des Kuppelraumes<br />
zu einem anderen Dialog zwischen<br />
Materialität und Licht kommt, da sich die<br />
filigrane Stahlkonstruktion des transluzenten<br />
Glasdaches im Licht aufzulösen scheint.<br />
1) Lageplan<br />
2) Innenraumeindruck Synagoge<br />
3) Grundriss 1.OG (Sakralräume)<br />
4) Ansichten und Schnitte