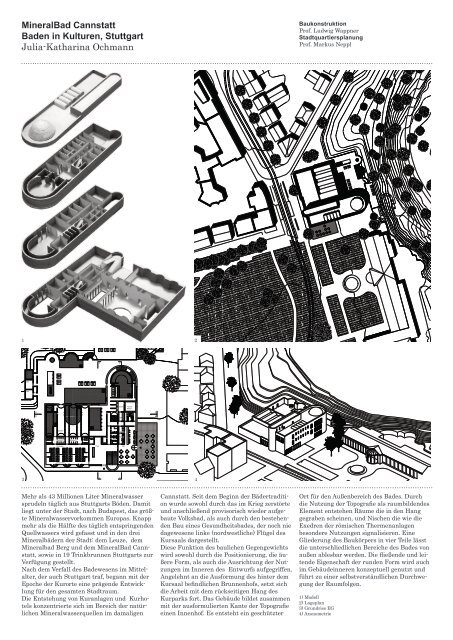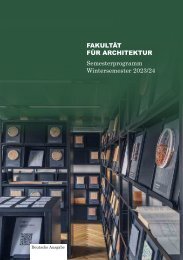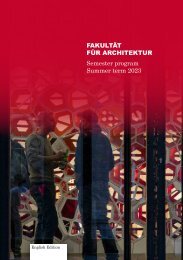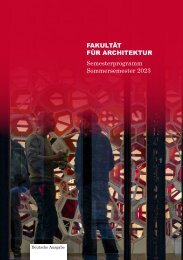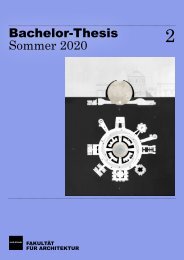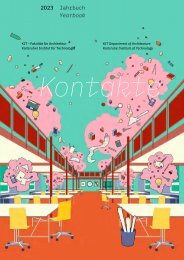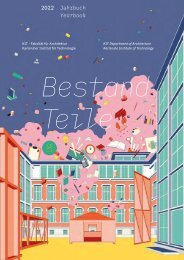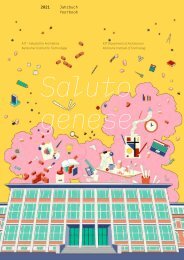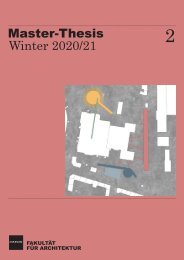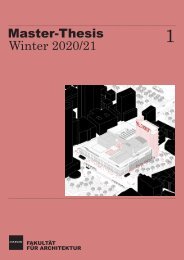KIT-Fakultät für Architektur – Master-Arbeiten Winter 2017/18
Dokumentation von Masterabschlussarbeiten des Wintersemesters 2017/18 an der Fakultät für Architektur am Karlsruher Institut für Technologie.
Dokumentation von Masterabschlussarbeiten des Wintersemesters 2017/18 an der Fakultät für Architektur am Karlsruher Institut für Technologie.
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
95°C<br />
MineralBad Cannstatt<br />
Baden in Kulturen, Stuttgart<br />
Julia-Katharina Ochmann<br />
Baukonstruktion<br />
Prof. Ludwig Wappner<br />
Stadtquartiersplanung<br />
Prof. Markus Neppl<br />
1<br />
2<br />
24°C<br />
C<br />
D<br />
<strong>18</strong>°C<br />
60°C<br />
16°C<br />
36°C<br />
A<br />
36°C<br />
30°C<br />
<strong>18</strong>°C<br />
Technik<br />
Technik<br />
Becken<br />
A<br />
B<br />
Lager<br />
B<br />
24°C<br />
Badehalle<br />
Lager<br />
Küche<br />
Duschen D<br />
Duschen H<br />
Umkleiden<br />
Foyer<br />
Café<br />
Bijoubereich<br />
3<br />
C<br />
D<br />
4<br />
Mehr als 43 Millionen Liter Mineralwasser<br />
sprudeln täglich aus Stuttgarts Böden. Damit<br />
liegt unter der Stadt, nach Budapest, das größte<br />
Mineralwasservorkommen Europas. Knapp<br />
mehr als die Hälfte des täglich entspringenden<br />
Quellwassers wird gefasst und in den drei<br />
Mineralbädern der Stadt: dem Leuze, dem<br />
Mineralbad Berg und dem MineralBad Cannstatt,<br />
sowie in 19 Trinkbrunnen Stuttgarts zur<br />
Verfügung gestellt.<br />
Nach dem Verfall des Badewesens im Mittelalter,<br />
der auch Stuttgart traf, begann mit der<br />
Epoche der Kurorte eine prägende Entwicklung<br />
<strong>für</strong> den gesamten Stadtraum.<br />
Die Entstehung von Kuranlagen und Kurhotels<br />
konzentrierte sich im Bereich der natürlichen<br />
Mineralwasserquellen im damaligen<br />
Cannstatt. Seit dem Beginn der Bädertradition<br />
wurde sowohl durch das im Krieg zerstörte<br />
und anschließend provisorisch wieder aufgebaute<br />
Volksbad, als auch durch den bestehenden<br />
Bau eines Gesundheitsbades, der noch nie<br />
dagewesene linke (nordwestliche) Flügel des<br />
Kursaals dargestellt.<br />
Diese Funktion des baulichen Gegengewichts<br />
wird sowohl durch die Positionierung, die äußere<br />
Form, als auch die Ausrichtung der Nutzungen<br />
im Inneren des Entwurfs aufgegriffen.<br />
Angelehnt an die Ausformung des hinter dem<br />
Kursaal befindlichen Brunnenhofs, setzt sich<br />
die Arbeit mit dem rückseitigen Hang des<br />
Kurparks fort. Das Gebäude bildet zusammen<br />
mit der ausformulierten Kante der Topografie<br />
einen Innenhof. Es entsteht ein geschützter<br />
Ort <strong>für</strong> den Außenbereich des Bades. Durch<br />
die Nutzung der Topografie als raumbildendes<br />
Element entstehen Räume die in den Hang<br />
gegraben scheinen, und Nischen die wie die<br />
Exedren der römischen Thermenanlagen<br />
besondere Nutzungen signalisieren. Eine<br />
Gliederung des Baukörpers in vier Teile lässt<br />
die unterschliedlichen Bereiche des Bades von<br />
außen ablesbar werden. Die fließende und leitende<br />
Eigenschaft der runden Form wird auch<br />
im Gebäudeinneren konzeptuell genutzt und<br />
führt zu einer selbstverständlichen Durchwegung<br />
der Raumfolgen.<br />
1) Modell<br />
2) Lageplan<br />
3) Grundriss EG<br />
4) Axonometrie