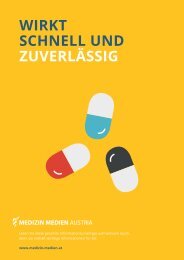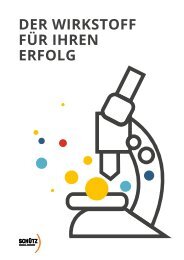CliniCum onko 06/2023
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
gänglich ist. Es wurde also getestet, ob die Zugabe eines<br />
PARP-Inhibitors den Tumor für eine Immuntherapie zugänglicher<br />
macht. Das hat sich nicht bewahrheitet. Die<br />
Studie hat ihren primären Endpunkt nicht erreicht. Trotzdem<br />
ist es eine wichtige Studie, weil man sieht, dass die<br />
Kombination aus Checkpoint-Inhibitor und PARP-Inhibitor<br />
nicht den gewünschten Effekt hat.<br />
„Wir brauchen bessere Biomarker, um differenzieren<br />
zu können, wer von der Therapie profitiert.<br />
PD-L1 ist kein sehr aussagekräftiger Marker.“<br />
Ao. Univ.-Prof.<br />
Dr. Alexander<br />
Reinthaller<br />
Abteilung für<br />
Gynäkologie &<br />
Gynäkologische<br />
Onkologie,<br />
Universitätsklinik<br />
für Frauenheilkunde,<br />
Gynäkologisches<br />
Tumorzentrum;<br />
Ordensklinikum<br />
Linz<br />
Zwei Phase-III-Studien deuten auf den Nutzen einer<br />
Immuntherapie bei Patientinnen mit fortgeschrittenem<br />
Endometriumkarzinom hin. Was lässt sich<br />
dazu sagen?<br />
Beginnen wir mit der DUO-E-Studie. Diese dreiarmige<br />
Studie hat beim fortgeschrittenen Endometriumkarzinom<br />
eine Kombination aus Chemotherapie (Carboplatin plus<br />
Taxol) plus/minus Durvalumab (PD-L1-Inhibitor) und in<br />
der anschließenden Erhaltungstherapie Placebo/Placebo<br />
vs. Durvalumab/Placebo vs. Durvalumab/Olaparib<br />
(PARP-Inhibitor) untersucht.<br />
In beiden expermimentellen Armen war ein Unterschied<br />
zum Kontrollarm zu sehen, wobei in der ITT-Population die<br />
Kombination mit Durvalumab plus Olaparib etwas bes ser<br />
performt hat. Wenn man sich die teilweise bemerkenswerten<br />
Ergebnisse der Subgruppenanalysen anschaut, sieht<br />
man, dass Olaparib keinen zusätzlichen Vorteil bei Missmatch-repair(MMR)-defizienten<br />
Patientinnen gebracht<br />
hat. Das ist nicht unerwartet, weil diese Patientinnen besonders<br />
gut auf eine Immuntherapie ansprechen. Ein<br />
PARP-Inhibitor scheint hier additiv nicht viel zu bringen.<br />
Bei der MMR-profizienten Gruppe konnte man einen Vorteil<br />
für beide experimentellen Therapiearme erkennen.<br />
In der Gruppe der PD-L1-positiven Patientinnen war ein<br />
deutlicher Vorteil mit Durvalumab/Olaparib zu sehen. Dieser<br />
Unterschied war in der PD-L1-negativen-Gruppe nicht<br />
erkennbar. Allerdings schnitten auch hier die experimentellen<br />
Therapiearme etwas besser ab als die Kontrolle.<br />
Fazit: Wir brauchen bessere Biomarker, um differenzieren<br />
zu können, wer wirklich von der Therapie profitiert. PD-L1<br />
ist kein sehr aussagekräftiger Marker. Zudem müssen die<br />
Langzeitergebnisse und Gesamtüberlebensraten abgewartet<br />
werden, um zu sehen, ob die Kombination z.B. bei der<br />
MMR-profizienten Gruppe einen deutlichen Effekt zeigt.<br />
Die zweite Studie, die AtTEnd-Studie, hat den PD-L1-Inhibitor<br />
Atezolizumab bei fortgeschrittenem Endometriumkarzinom<br />
nach Chemotherapie in der Erstlinie untersucht,<br />
inklusive einer Erhaltungstherapie. Im Wesentlichen<br />
haben sich die Daten bestätigt, die wir aus den vorangegangenen<br />
Studien RUBY und NRG-GY018 kennen.<br />
Der Checkpoint-Inhibitor war hocheffektiv, insbesondere<br />
in der Gruppe der MMR-defizienten Patientinnen.<br />
Es gibt immer wieder die Diskussion, ob nicht der PD1-<br />
Inhibitor etwas effektiver als der PD-L1-Inhibitor ist. Bis<br />
dato gibt es aber keinen Head-to-head-Vergleich. Wir können<br />
es also nicht wirklich sagen. Die AtTEnd-Studie hat<br />
das bestätigt, was wir schon wissen. Sie ist also eine konfirmative<br />
Studie – was wichtig ist –, hat aber keinen Booster<br />
an neuen Erkenntnissen gebracht.<br />
Was erwartet uns in nächster Zukunft im Bereich<br />
der gynäkologischen Krebserkrankungen?<br />
Im Bereich der Antibody-drug conjugates tut sich gerade<br />
sehr viel. Durch modifizierte Linker-Proteine, auch enzymatisch<br />
teilbar und damit peripher stabiler, werden wir<br />
höchstwahrscheinlich weitere Verbesserungen im Hinblick<br />
auf Wirkung und Toxizität sehen. Weiters erwarten<br />
wir Studiendaten zu Tumorvakzinen beim Ovarialkarzinom.<br />
Interessant ist auch die Kombination aus mRNA-<br />
Vakzinen und Checkpoint-Inhibitoren. Zurzeit wird außerdem<br />
ein modifiziertes Interleukin-2 in klinischen Studien<br />
untersucht, das eine deutlich geringere Toxizität<br />
aufweist als frühere Optionen. Es sind also spannende<br />
Ausblicke und es kommt sicher noch einiges auf uns zu.<br />
Vielen Dank für das Gespräch!<br />
Krebs<br />
kennt<br />
keine<br />
Grenzen.<br />
1123-BRU-PRC-005<br />
©gettyimages/luismolina