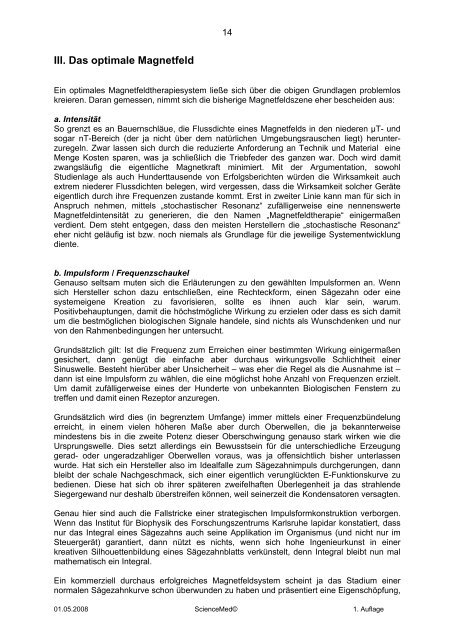Gerätefeatures, Wirkmodell und Studienlage der Magnetfeldtherapie ...
Gerätefeatures, Wirkmodell und Studienlage der Magnetfeldtherapie ...
Gerätefeatures, Wirkmodell und Studienlage der Magnetfeldtherapie ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
III. Das optimale Magnetfeld<br />
14<br />
Ein optimales <strong>Magnetfeldtherapie</strong>system ließe sich über die obigen Gr<strong>und</strong>lagen problemlos<br />
kreieren. Daran gemessen, nimmt sich die bisherige Magnetfeldszene eher bescheiden aus:<br />
a. Intensität<br />
So grenzt es an Bauernschläue, die Flussdichte eines Magnetfelds in den nie<strong>der</strong>en µT- <strong>und</strong><br />
sogar nT-Bereich (<strong>der</strong> ja nicht über dem natürlichen Umgebungsrauschen liegt) herunterzuregeln.<br />
Zwar lassen sich durch die reduzierte Anfor<strong>der</strong>ung an Technik <strong>und</strong> Material eine<br />
Menge Kosten sparen, was ja schließlich die Triebfe<strong>der</strong> des ganzen war. Doch wird damit<br />
zwangsläufig die eigentliche Magnetkraft minimiert. Mit <strong>der</strong> Argumentation, sowohl<br />
<strong>Studienlage</strong> als auch H<strong>und</strong>erttausende von Erfolgsberichten würden die Wirksamkeit auch<br />
extrem nie<strong>der</strong>er Flussdichten belegen, wird vergessen, dass die Wirksamkeit solcher Geräte<br />
eigentlich durch ihre Frequenzen zustande kommt. Erst in zweiter Linie kann man für sich in<br />
Anspruch nehmen, mittels „stochastischer Resonanz“ zufälligerweise eine nennenswerte<br />
Magnetfeldintensität zu generieren, die den Namen „<strong>Magnetfeldtherapie</strong>“ einigermaßen<br />
verdient. Dem steht entgegen, dass den meisten Herstellern die „stochastische Resonanz“<br />
eher nicht geläufig ist bzw. noch niemals als Gr<strong>und</strong>lage für die jeweilige Systementwicklung<br />
diente.<br />
b. Impulsform / Frequenzschaukel<br />
Genauso seltsam muten sich die Erläuterungen zu den gewählten Impulsformen an. Wenn<br />
sich Hersteller schon dazu entschließen, eine Rechteckform, einen Sägezahn o<strong>der</strong> eine<br />
systemeigene Kreation zu favorisieren, sollte es ihnen auch klar sein, warum.<br />
Positivbehauptungen, damit die höchstmögliche Wirkung zu erzielen o<strong>der</strong> dass es sich damit<br />
um die bestmöglichen biologischen Signale handele, sind nichts als Wunschdenken <strong>und</strong> nur<br />
von den Rahmenbedingungen her untersucht.<br />
Gr<strong>und</strong>sätzlich gilt: Ist die Frequenz zum Erreichen einer bestimmten Wirkung einigermaßen<br />
gesichert, dann genügt die einfache aber durchaus wirkungsvolle Schlichtheit einer<br />
Sinuswelle. Besteht hierüber aber Unsicherheit – was eher die Regel als die Ausnahme ist –<br />
dann ist eine Impulsform zu wählen, die eine möglichst hohe Anzahl von Frequenzen erzielt.<br />
Um damit zufälligerweise eines <strong>der</strong> H<strong>und</strong>erte von unbekannten Biologischen Fenstern zu<br />
treffen <strong>und</strong> damit einen Rezeptor anzuregen.<br />
Gr<strong>und</strong>sätzlich wird dies (in begrenztem Umfange) immer mittels einer Frequenzbündelung<br />
erreicht, in einem vielen höheren Maße aber durch Oberwellen, die ja bekannterweise<br />
mindestens bis in die zweite Potenz dieser Oberschwingung genauso stark wirken wie die<br />
Ursprungswelle. Dies setzt allerdings ein Bewusstsein für die unterschiedliche Erzeugung<br />
gerad- o<strong>der</strong> ungeradzahliger Oberwellen voraus, was ja offensichtlich bisher unterlassen<br />
wurde. Hat sich ein Hersteller also im Idealfalle zum Sägezahnimpuls durchgerungen, dann<br />
bleibt <strong>der</strong> schale Nachgeschmack, sich einer eigentlich verunglückten E-Funktionskurve zu<br />
bedienen. Diese hat sich ob ihrer späteren zweifelhaften Überlegenheit ja das strahlende<br />
Siegergewand nur deshalb überstreifen können, weil seinerzeit die Kondensatoren versagten.<br />
Genau hier sind auch die Fallstricke einer strategischen Impulsformkonstruktion verborgen.<br />
Wenn das Institut für Biophysik des Forschungszentrums Karlsruhe lapidar konstatiert, dass<br />
nur das Integral eines Sägezahns auch seine Applikation im Organismus (<strong>und</strong> nicht nur im<br />
Steuergerät) garantiert, dann nützt es nichts, wenn sich hohe Ingenieurkunst in einer<br />
kreativen Silhouettenbildung eines Sägezahnblatts verkünstelt, denn Integral bleibt nun mal<br />
mathematisch ein Integral.<br />
Ein kommerziell durchaus erfolgreiches Magnetfeldsystem scheint ja das Stadium einer<br />
normalen Sägezahnkurve schon überw<strong>und</strong>en zu haben <strong>und</strong> präsentiert eine Eigenschöpfung,<br />
01.05.2008 ScienceMed© 1. Auflage