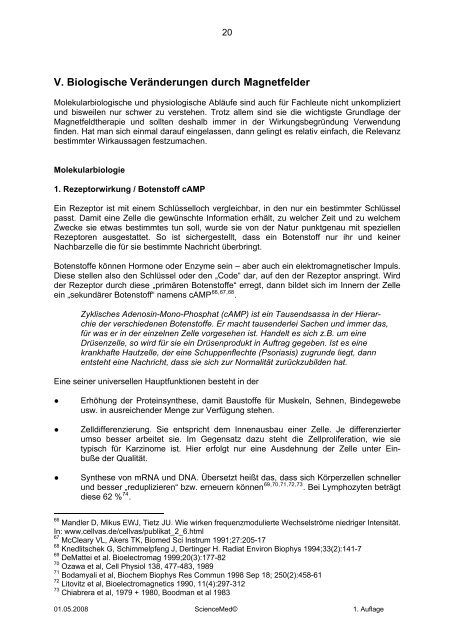Gerätefeatures, Wirkmodell und Studienlage der Magnetfeldtherapie ...
Gerätefeatures, Wirkmodell und Studienlage der Magnetfeldtherapie ...
Gerätefeatures, Wirkmodell und Studienlage der Magnetfeldtherapie ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
20<br />
V. Biologische Verän<strong>der</strong>ungen durch Magnetfel<strong>der</strong><br />
Molekularbiologische <strong>und</strong> physiologische Abläufe sind auch für Fachleute nicht unkompliziert<br />
<strong>und</strong> bisweilen nur schwer zu verstehen. Trotz allem sind sie die wichtigste Gr<strong>und</strong>lage <strong>der</strong><br />
<strong>Magnetfeldtherapie</strong> <strong>und</strong> sollten deshalb immer in <strong>der</strong> Wirkungsbegründung Verwendung<br />
finden. Hat man sich einmal darauf eingelassen, dann gelingt es relativ einfach, die Relevanz<br />
bestimmter Wirkaussagen festzumachen.<br />
Molekularbiologie<br />
1. Rezeptorwirkung / Botenstoff cAMP<br />
Ein Rezeptor ist mit einem Schlüsselloch vergleichbar, in den nur ein bestimmter Schlüssel<br />
passt. Damit eine Zelle die gewünschte Information erhält, zu welcher Zeit <strong>und</strong> zu welchem<br />
Zwecke sie etwas bestimmtes tun soll, wurde sie von <strong>der</strong> Natur punktgenau mit speziellen<br />
Rezeptoren ausgestattet. So ist sichergestellt, dass ein Botenstoff nur ihr <strong>und</strong> keiner<br />
Nachbarzelle die für sie bestimmte Nachricht überbringt.<br />
Botenstoffe können Hormone o<strong>der</strong> Enzyme sein – aber auch ein elektromagnetischer Impuls.<br />
Diese stellen also den Schlüssel o<strong>der</strong> den „Code“ dar, auf den <strong>der</strong> Rezeptor anspringt. Wird<br />
<strong>der</strong> Rezeptor durch diese „primären Botenstoffe“ erregt, dann bildet sich im Innern <strong>der</strong> Zelle<br />
66, ,<br />
ein „sek<strong>und</strong>ärer Botenstoff“ namens cAMP<br />
67 68 .<br />
Zyklisches Adenosin-Mono-Phosphat (cAMP) ist ein Tausendsassa in <strong>der</strong> Hierarchie<br />
<strong>der</strong> verschiedenen Botenstoffe. Er macht tausen<strong>der</strong>lei Sachen <strong>und</strong> immer das,<br />
für was er in <strong>der</strong> einzelnen Zelle vorgesehen ist. Handelt es sich z.B. um eine<br />
Drüsenzelle, so wird für sie ein Drüsenprodukt in Auftrag gegeben. Ist es eine<br />
krankhafte Hautzelle, <strong>der</strong> eine Schuppenflechte (Psoriasis) zugr<strong>und</strong>e liegt, dann<br />
entsteht eine Nachricht, dass sie sich zur Normalität zurückzubilden hat.<br />
Eine seiner universellen Hauptfunktionen besteht in <strong>der</strong><br />
● Erhöhung <strong>der</strong> Proteinsynthese, damit Baustoffe für Muskeln, Sehnen, Bindegewebe<br />
usw. in ausreichen<strong>der</strong> Menge zur Verfügung stehen.<br />
● Zelldifferenzierung. Sie entspricht dem Innenausbau einer Zelle. Je differenzierter<br />
umso besser arbeitet sie. Im Gegensatz dazu steht die Zellproliferation, wie sie<br />
typisch für Karzinome ist. Hier erfolgt nur eine Ausdehnung <strong>der</strong> Zelle unter Ein-<br />
buße <strong>der</strong> Qualität.<br />
● Synthese von mRNA <strong>und</strong> DNA. Übersetzt heißt das, dass sich Körperzellen schneller<br />
69, , , ,<br />
<strong>und</strong> besser „reduplizieren“ bzw. erneuern können 70 71 72 73 . Bei Lymphozyten beträgt<br />
diese 62 % 74 .<br />
66<br />
Mandler D, Mikus EWJ, Tietz JU. Wie wirken frequenzmodulierte Wechselströme niedriger Intensität.<br />
In: www.cellvas.de/cellvas/publikat_2_6.html<br />
67<br />
McCleary VL, Akers TK, Biomed Sci Instrum 1991;27:205-17<br />
68<br />
Knedlitschek G, Schimmelpfeng J, Dertinger H. Radiat Environ Biophys 1994;33(2):141-7<br />
69<br />
DeMattei et al. Bioelectromag 1999;20(3):177-82<br />
70<br />
Ozawa et al, Cell Physiol 138, 477-483, 1989<br />
71<br />
Bodamyali et al, Biochem Biophys Res Commun 1998 Sep 18; 250(2):458-61<br />
72<br />
Litovitz et al, Bioelectromagnetics 1990, 11(4):297-312<br />
73<br />
Chiabrera et al, 1979 + 1980, Boodman et al 1983<br />
01.05.2008 ScienceMed© 1. Auflage