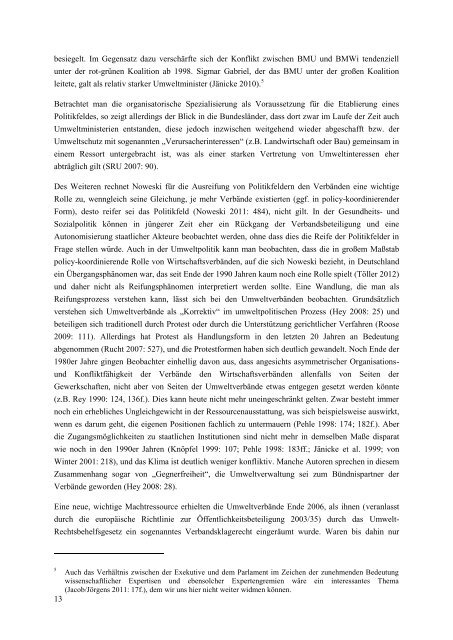Böcher, Michael / Töller, Annette - DVPW
Böcher, Michael / Töller, Annette - DVPW
Böcher, Michael / Töller, Annette - DVPW
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
esiegelt. Im Gegensatz dazu verschärfte sich der Konflikt zwischen BMU und BMWi tendenziell<br />
unter der rot-grünen Koalition ab 1998. Sigmar Gabriel, der das BMU unter der großen Koalition<br />
leitete, galt als relativ starker Umweltminister (Jänicke 2010). 5<br />
Betrachtet man die organisatorische Spezialisierung als Voraussetzung für die Etablierung eines<br />
Politikfeldes, so zeigt allerdings der Blick in die Bundesländer, dass dort zwar im Laufe der Zeit auch<br />
Umweltministerien entstanden, diese jedoch inzwischen weitgehend wieder abgeschafft bzw. der<br />
Umweltschutz mit sogenannten „Verursacherinteressen“ (z.B. Landwirtschaft oder Bau) gemeinsam in<br />
einem Ressort untergebracht ist, was als einer starken Vertretung von Umweltinteressen eher<br />
abträglich gilt (SRU 2007: 90).<br />
Des Weiteren rechnet Noweski für die Ausreifung von Politikfeldern den Verbänden eine wichtige<br />
Rolle zu, wenngleich seine Gleichung, je mehr Verbände existierten (ggf. in policy-koordinierender<br />
Form), desto reifer sei das Politikfeld (Noweski 2011: 484), nicht gilt. In der Gesundheits- und<br />
Sozialpolitik können in jüngerer Zeit eher ein Rückgang der Verbandsbeteiligung und eine<br />
Autonomisierung staatlicher Akteure beobachtet werden, ohne dass dies die Reife der Politikfelder in<br />
Frage stellen würde. Auch in der Umweltpolitik kann man beobachten, dass die in großem Maßstab<br />
policy-koordinierende Rolle von Wirtschaftsverbänden, auf die sich Noweski bezieht, in Deutschland<br />
ein Übergangsphänomen war, das seit Ende der 1990 Jahren kaum noch eine Rolle spielt (<strong>Töller</strong> 2012)<br />
und daher nicht als Reifungsphänomen interpretiert werden sollte. Eine Wandlung, die man als<br />
Reifungsprozess verstehen kann, lässt sich bei den Umweltverbänden beobachten. Grundsätzlich<br />
verstehen sich Umweltverbände als „Korrektiv“ im umweltpolitischen Prozess (Hey 2008: 25) und<br />
beteiligen sich traditionell durch Protest oder durch die Unterstützung gerichtlicher Verfahren (Roose<br />
2009: 111). Allerdings hat Protest als Handlungsform in den letzten 20 Jahren an Bedeutung<br />
abgenommen (Rucht 2007: 527), und die Protestformen haben sich deutlich gewandelt. Noch Ende der<br />
1980er Jahre gingen Beobachter einhellig davon aus, dass angesichts asymmetrischer Organisations-<br />
und Konfliktfähigkeit der Verbände den Wirtschaftsverbänden allenfalls von Seiten der<br />
Gewerkschaften, nicht aber von Seiten der Umweltverbände etwas entgegen gesetzt werden könnte<br />
(z.B. Rey 1990: 124, 136f.). Dies kann heute nicht mehr uneingeschränkt gelten. Zwar besteht immer<br />
noch ein erhebliches Ungleichgewicht in der Ressourcenausstattung, was sich beispielsweise auswirkt,<br />
wenn es darum geht, die eigenen Positionen fachlich zu untermauern (Pehle 1998: 174; 182f.). Aber<br />
die Zugangsmöglichkeiten zu staatlichen Institutionen sind nicht mehr in demselben Maße disparat<br />
wie noch in den 1990er Jahren (Knöpfel 1999: 107; Pehle 1998: 183ff.; Jänicke et al. 1999; von<br />
Winter 2001: 218), und das Klima ist deutlich weniger konfliktiv. Manche Autoren sprechen in diesem<br />
Zusammenhang sogar von „Gegnerfreiheit“, die Umweltverwaltung sei zum Bündnispartner der<br />
Verbände geworden (Hey 2008: 28).<br />
Eine neue, wichtige Machtressource erhielten die Umweltverbände Ende 2006, als ihnen (veranlasst<br />
durch die europäische Richtlinie zur Öffentlichkeitsbeteiligung 2003/35) durch das Umwelt-<br />
Rechtsbehelfsgesetz ein sogenanntes Verbandsklagerecht eingeräumt wurde. Waren bis dahin nur<br />
5<br />
Auch das Verhältnis zwischen der Exekutive und dem Parlament im Zeichen der zunehmenden Bedeutung<br />
wissenschaftlicher Expertisen und ebensolcher Expertengremien wäre ein interessantes Thema<br />
(Jacob/Jörgens 2011: 17f.), dem wir uns hier nicht weiter widmen können.<br />
13