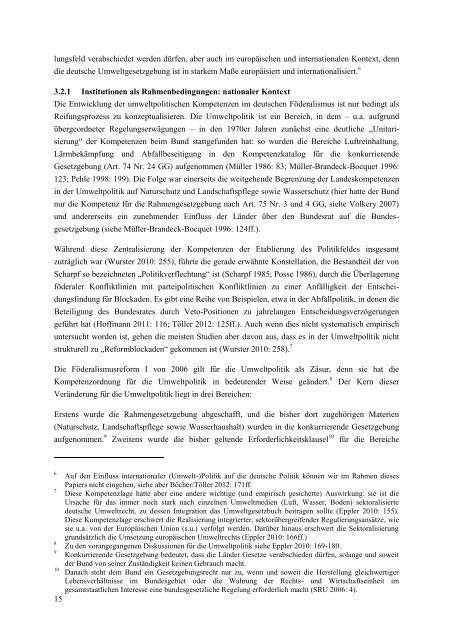Böcher, Michael / Töller, Annette - DVPW
Böcher, Michael / Töller, Annette - DVPW
Böcher, Michael / Töller, Annette - DVPW
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
lungsfeld verabschiedet werden dürfen, aber auch im europäischen und internationalen Kontext, denn<br />
die deutsche Umweltgesetzgebung ist in starkem Maße europäisiert und internationalisiert. 6<br />
3.2.1 Institutionen als Rahmenbedingungen: nationaler Kontext<br />
Die Entwicklung der umweltpolitischen Kompetenzen im deutschen Föderalismus ist nur bedingt als<br />
Reifungsprozess zu konzeptualisieren. Die Umweltpolitik ist ein Bereich, in dem – u.a. aufgrund<br />
übergeordneter Regelungserwägungen – in den 1970er Jahren zunächst eine deutliche „Unitari-<br />
sierung“ der Kompetenzen beim Bund stattgefunden hat: so wurden die Bereiche Luftreinhaltung,<br />
Lärmbekämpfung und Abfallbeseitigung in den Kompetenzkatalog für die konkurrierende<br />
Gesetzgebung (Art. 74 Nr. 24 GG) aufgenommen (Müller 1986: 83; Müller-Brandeck-Bocquet 1996:<br />
123; Pehle 1998: 199). Die Folge war einerseits die weitgehende Begrenzung der Landeskompetenzen<br />
in der Umweltpolitik auf Naturschutz und Landschaftspflege sowie Wasserschutz (hier hatte der Bund<br />
nur die Kompetenz für die Rahmengesetzgebung nach Art. 75 Nr. 3 und 4 GG, siehe Volkery 2007)<br />
und andererseits ein zunehmender Einfluss der Länder über den Bundesrat auf die Bundes-<br />
gesetzgebung (siehe Müller-Brandeck-Bocquet 1996: 124ff.).<br />
Während diese Zentralisierung der Kompetenzen der Etablierung des Politikfeldes insgesamt<br />
zuträglich war (Wurster 2010: 255), führte die gerade erwähnte Konstellation, die Bestandteil der von<br />
Scharpf so bezeichneten „Politikverflechtung“ ist (Scharpf 1985; Posse 1986), durch die Überlagerung<br />
föderaler Konfliktlinien mit parteipolitischen Konfliktlinien zu einer Anfälligkeit der Entschei-<br />
dungsfindung für Blockaden. Es gibt eine Reihe von Beispielen, etwa in der Abfallpolitik, in denen die<br />
Beteiligung des Bundesrates durch Veto-Positionen zu jahrelangen Entscheidungsverzögerungen<br />
geführt hat (Hoffmann 2011: 116; <strong>Töller</strong> 2012: 125ff.). Auch wenn dies nicht systematisch empirisch<br />
untersucht worden ist, gehen die meisten Studien aber davon aus, dass es in der Umweltpolitik nicht<br />
strukturell zu „Reformblockaden“ gekommen ist (Wurster 2010: 258). 7<br />
Die Föderalismusreform I von 2006 gilt für die Umweltpolitik als Zäsur, denn sie hat die<br />
Kompetenzordnung für die Umweltpolitik in bedeutender Weise geändert. 8 Der Kern dieser<br />
Veränderung für die Umweltpolitik liegt in drei Bereichen:<br />
Erstens wurde die Rahmengesetzgebung abgeschafft, und die bisher dort zugehörigen Materien<br />
(Naturschutz, Landschaftspflege sowie Wasserhaushalt) wurden in die konkurrierende Gesetzgebung<br />
aufgenommen. 9 Zweitens wurde die bisher geltende Erforderlichkeitsklausel 10 für die Bereiche<br />
6<br />
Auf den Einfluss internationaler (Umwelt-)Politik auf die deutsche Politik können wir im Rahmen dieses<br />
Papiers nicht eingehen, siehe aber <strong>Böcher</strong>/<strong>Töller</strong> 2012: 171ff.<br />
7<br />
Diese Kompetenzlage hatte aber eine andere wichtige (und empirisch gesicherte) Auswirkung: sie ist die<br />
Ursache für das immer noch stark nach einzelnen Umweltmedien (Luft, Wasser, Boden) sektoralisierte<br />
deutsche Umweltrecht, zu dessen Integration das Umweltgesetzbuch beitragen sollte (Eppler 2010: 155).<br />
Diese Kompetenzlage erschwert die Realisierung integrierter, sektorübergreifender Regulierungsansätze, wie<br />
sie u.a. von der Europäischen Union (s.u.) verfolgt werden. Darüber hinaus erschwert die Sektoralisierung<br />
grundsätzlich die Umsetzung europäischen Umweltrechts (Eppler 2010: 166ff.)<br />
8<br />
Zu den vorangegangenen Diskussionen für die Umweltpolitik siehe Eppler 2010: 169-180.<br />
9<br />
Konkurrierende Gesetzgebung bedeutet, dass die Länder Gesetze verabschieden dürfen, solange und soweit<br />
der Bund von seiner Zuständigkeit keinen Gebrauch macht.<br />
10<br />
Danach steht dem Bund ein Gesetzgebungsrecht nur zu, wenn und soweit die Herstellung gleichwertiger<br />
Lebensverhältnisse im Bundesgebiet oder die Wahrung der Rechts- und Wirtschaftseinheit im<br />
gesamtstaatlichen Interesse eine bundesgesetzliche Regelung erforderlich macht (SRU 2006: 4).<br />
15